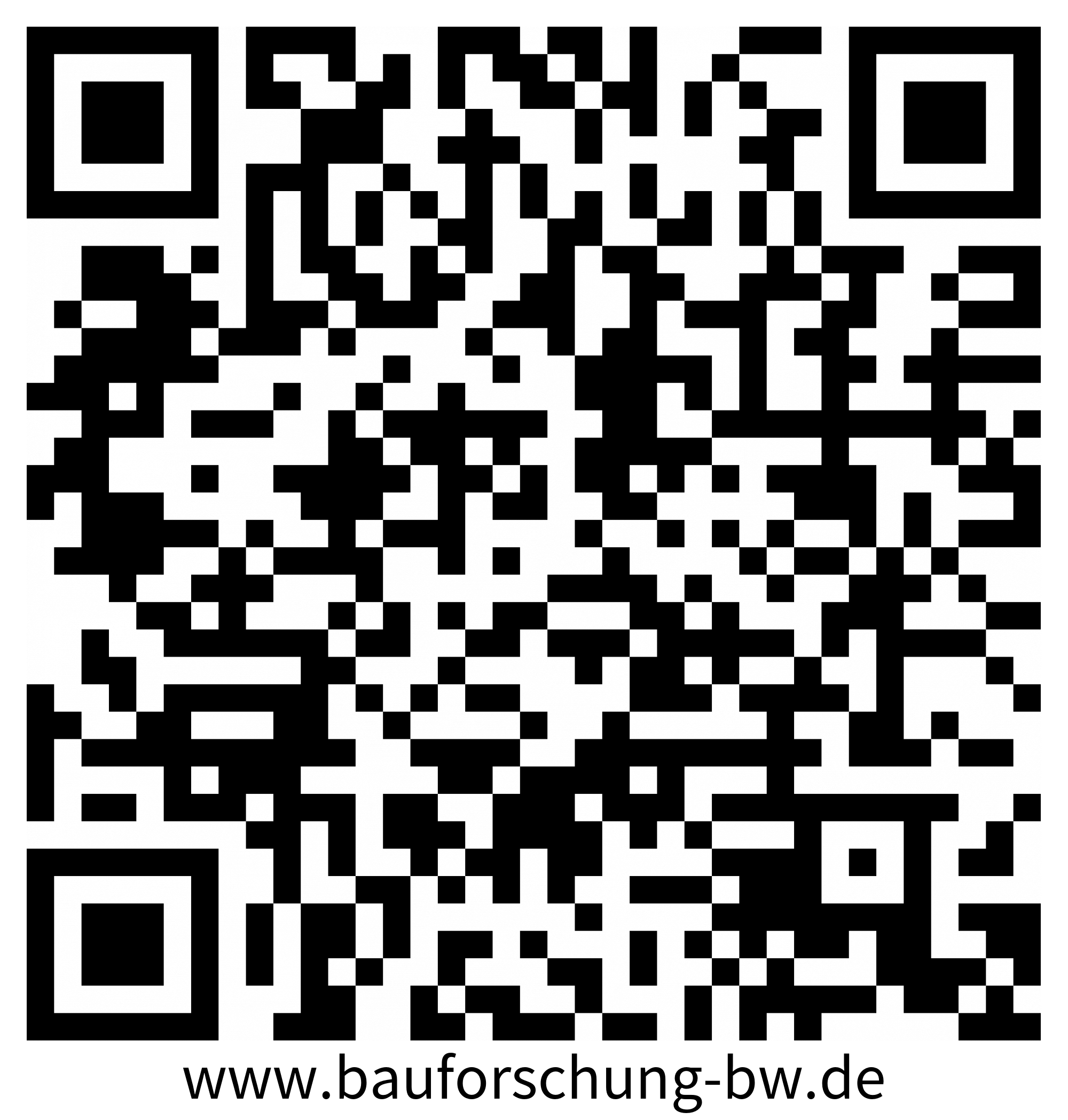Marienkirche (ev. Stadtkirche St. Maria), Turmhelm
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Weibermarkt |
| Hausnummer: | 1 |
| Postleitzahl: | 72764 |
| Stadt-Teilort: | Reutlingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Reutlingen (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8415061015 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Objektbeziehungen
| Ist Gebäudeteil von: | |
| 1. Gebäudeteil: | Marienkirche (ev. Stadtkirche St. Maria) |
|
|
|
| Besteht aus folgenden Gebäudeteilen: | |
| keine Angabe | |
Fachwerkhaus, Albstraße 4 (72764 Reutlingen)
Ehem. Dekanatsgebäude, Aulberstraße 1 (72764 Reutlingen)
Fachwerkhaus, Bebenhäuserhofstraße 4 (72764 Reutlingen)
Fachwerkhaus, Kanzleistraße 24 (72764 Reutlingen)
ehem. Dienerwohnung des Reutlinger Oberamtes, Kanzleistraße 26 (72765 Reutlingen)
Wohn- und Geschäftshaus (72764 Reutlingen, Katharinenstraße 14)
Wohnhaus, Katharinenstraße 16 (72764 Reutlingen)
Pfarrwaschhaus, Krämerstraße 14 (72764 Reutlingen)
Ehem. Helferratsgebäude, Metzgerstraße 56 (72765 Reutlingen)
Scheune des Nürtinger Pfleghofs, Nürtingerhofstraße 12/1 (72764 Reutlingen)
Heimatmuseum (72764 Reutlingen, Oberamteistraße 22)
Marienkirche (ev. Stadtkirche St. Maria), Apostelfiguren Nordseite (72764 Reutlingen, Weibermarkt 1)
Marienkirche (ev. Stadtkirche St. Maria) (72764 Reutlingen, Weibermarkt 1)
Bauphasen
Der Beginn des Bauvorgangs kann grob auf ca. 1310 festgelegt werden. Vollendet wurde der Turm nachweislich 1343. Bauunterbrechungen können nicht ausgeschlossen werden, jedoch sind keine Bauphasen im eigentlichen Sinne zu unterscheiden.
Für den weiteren Verlauf des 14. Und für beinahe das gesamte 15. Jahrhundert können keine weiteren Bauarbeiten am Turmhelm anhand des Baubefunds einwandfrei belegt werden. Es ist lediglich sehr wahrscheinlich, dass der Glockenbaldachin nach dem Blitzeinschlag von 1494 errichtet wurde.
Mehrere Befunde sprechen dafür, dass bei besagtem Blitzeinschlag die Turmspitze nicht zerstört wurde, sondern lediglich ihr Gefüge in einer Weise geschädigt wurde, dass es nicht mehr ausreichend kraftschlüssig war. Folge war ein systematischer Abbau der gesamten Turmhelms bis knapp unterhalb des ersten Umgangs. Anschließend wurden alle Steine wieder neu an Ort und Stelle versetzt.
Alle jüngeren Eingriffe und selbst jener aus dem späten 15. Jahrhundert hatten keineswegs die Veränderung der äußeren Erscheinung des Turms, sondern vielmehr deren Bewahrung zum Ziel. Insofern kann geschlossen damit werden, dass die Stilreinheit des Turms bzw. des Turmhelms der Marienkirche trotz aller Beschädigungen, die er im Lauf der Jahrhunderte erfahren hat, weitgehend unverfälscht bewahrt geblieben ist. Zahlreiche weitere Restaurierungsmaßnahmen bis in die Neuzeit folgten.
(1305 - 1310)
(1310 - 1325)
(1310 - 1343)
(1494 - 1496)
Systematischer Abbau der gesamten Turmhelms bis knapp unterhalb des ersten Umgangs. Anschließend wurden alle Steine wieder neu an Ort und Stelle versetzt.
(1726 - 1728)
(1779 - 1795)
(1825 - 1870)
(1860 - 1899)
(1943 - 1980)
(2006 - 2010)
Zugeordnete Dokumentationen
- Ergebnisse der baubegleitenden bauhistorischen Untersuchungen am Turmhelm
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Sakralbauten
- Kirche, allgemein
Zonierung:
Glockenbaldachin mit 2 Glocken
Konstruktionen
- Steinbau Mauerwerk
- Betonbau
- sonstige Kunststeine
- Werkstein
- Dachform
- Turmhelm
- Gestaltungselemente
- Zierglieder im Steinbau
Der Zusammenhalt der Bausteine des Turms wird durch Eisenklammern verstärkt, die sich anhand ihrer Anordnung im Gefüge und Verteilung am Helm in mehrere Gruppen unterscheiden lassen. Am stärksten vertreten sind in den Lagerfugen zwischen den Blockschichten eingelassene Klammern, die jeweils die Stoßfugen zweier Blöcke überfassen. Daneben treten im oberen Bereich des Turmhelms Klammern auf, welche die Lagerfugen zwischen den Schichten vertikal überfassen.
Die Klammern in den Lagerfugen sind nicht untereinander verbunden; sie bilden somit auch kein festes Gefüge bzw. keinen Ring, der Vertikal einwirkende Belastungsspitzen ausgleichen könnte. Dennoch ist ihre Funktion insofern im Sinne eines Ringankers zu verstehen, als dass sie dem Verrutschen einzelner Blöcke aus dem Gefüge oder gar deren Ausbrechen aufgrund spezifischer Krafteinwirkungen entgegenwirken.
Die vertikalen Klammern treten, wie bereits erwähnt, lediglich im Bereich der Turmspitze auf. Sie sind zweifelsohne als Maßnahme gegen horizontal einwirkenden Windlasten bzw. einem Abknicken der bei entsprechender Krafteinwirkung in besonderem Maße gefährdeten Turmspitze (z.B. bei Erdbeben) zu interpretieren.
Sowohl das Gesims, welches den oberen Umlauf trägt, als auch die den Turmhelm bekrönende Kreuzblume bestehen aus armiertem Beton. Umlauf, Kreuzblume und die Betonverfüllung der Spitze im Innern des Helms bilden eine konstruktive Einheit. Die Erneuerung der Kreuzblume und des Umlaufs sowie der Ausguss des Innern der Helmspitze erfolgte 1950. Der erneuerte Umlauf bildet eine feste Einheit und wirkt als Ringanker. Die ebenfalls in den 1950er Jahren eingebauten Spindel im Innern des Turms ist mittels Spannankern mit dem Turmhelm verbunden und stärkt so dessen Zusammenhalt.