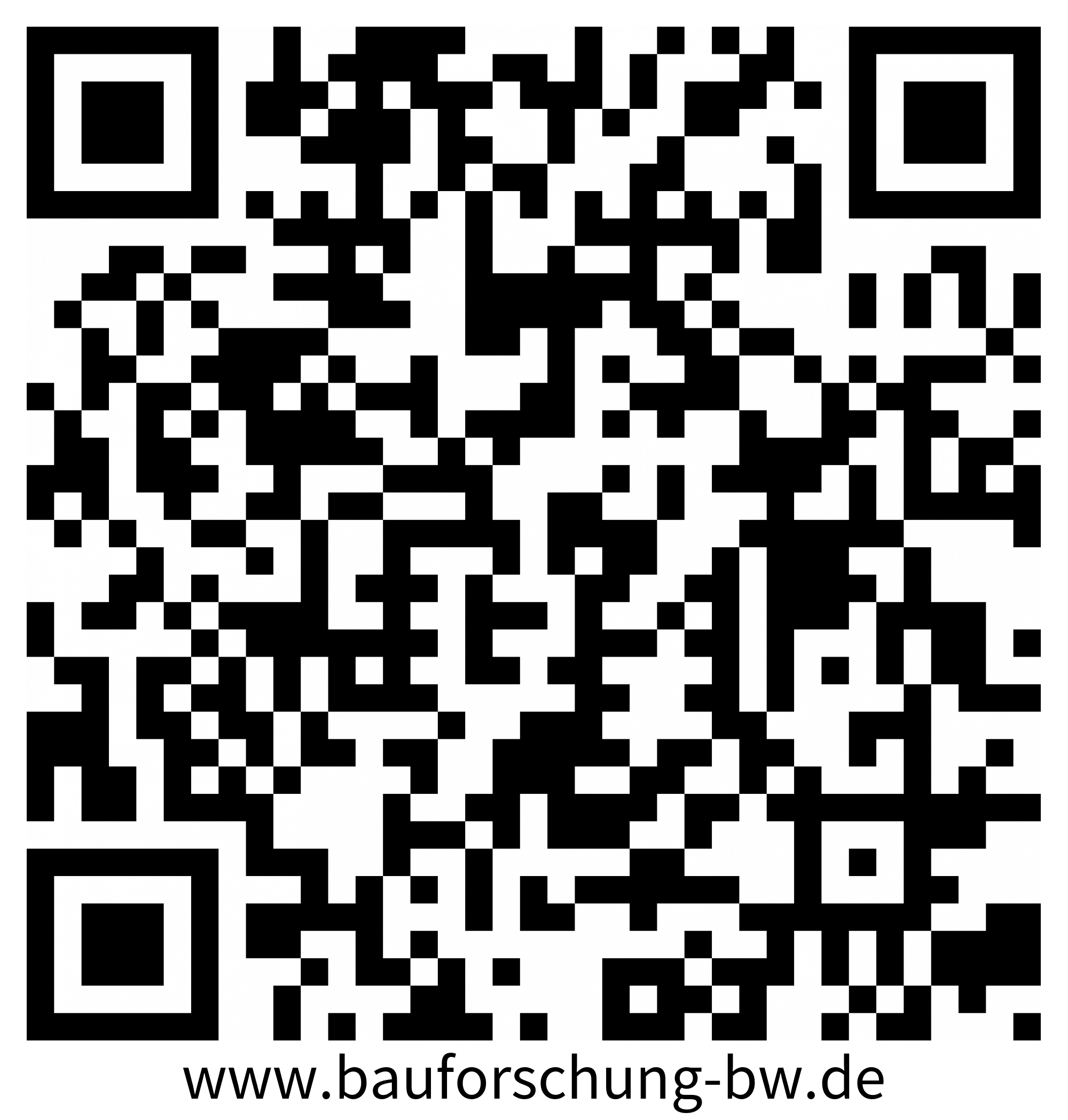Ehem. Helferratsgebäude
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Metzgerstraße |
| Hausnummer: | 56 |
| Postleitzahl: | 72765 |
| Stadt-Teilort: | Reutlingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Reutlingen (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8415061015 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Fachwerkhaus, Albstraße 4 (72764 Reutlingen)
Ehem. Dekanatsgebäude, Aulberstraße 1 (72764 Reutlingen)
Fachwerkhaus, Bebenhäuserhofstraße 4 (72764 Reutlingen)
Fachwerkhaus, Kanzleistraße 24 (72764 Reutlingen)
ehem. Dienerwohnung des Reutlinger Oberamtes, Kanzleistraße 26 (72765 Reutlingen)
Wohn- und Geschäftshaus (72764 Reutlingen, Katharinenstraße 14)
Wohnhaus, Katharinenstraße 16 (72764 Reutlingen)
Pfarrwaschhaus, Krämerstraße 14 (72764 Reutlingen)
Scheune des Nürtinger Pfleghofs, Nürtingerhofstraße 12/1 (72764 Reutlingen)
Heimatmuseum (72764 Reutlingen, Oberamteistraße 22)
Marienkirche (ev. Stadtkirche St. Maria), Apostelfiguren Nordseite (72764 Reutlingen, Weibermarkt 1)
Marienkirche (ev. Stadtkirche St. Maria) (72764 Reutlingen, Weibermarkt 1)
Marienkirche (ev. Stadtkirche St. Maria), Turmhelm (72764 Reutlingen, Weibermarkt 1)
Bauphasen
Aufgrund der vorliegenden Archivalien kann das Baudatum des jetzigen Gebäudes mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahr 1729 angesiedelt werden. Diese Datierung erklärt auch die im Vergleich zur schräg gegenüberliegenden Fassade des Gebäudes Aulberstraße 1 (errichtet 1770) eher altertümlich wirkende Gestaltung der Giebelseite mit Geschossvorkragungen.
Ein höheres Alter des Kellers und evtl. einzelner Bereiche des Erdgeschosses kann aufgrund der Grundrisslage und weiterer Indizien (wie z. B. Mauerstärke) angenommen werden. Eine mögliche Bauabfolge wäre der Aufbau eines Gebäudes über älterem Keller schon vor dem Stadtbrand von 1726. Nach dem Brand wurden hier nicht alle Reste beseitigt wie dies nach Aussage der Quellen in der Aulberstraße 1 geschah, sondern man nutzte vorhandene Mauern des Kellers und evtl. des Erdgeschosses weiter und errichtete darüber ein neues Pfarrhaus, das sich in den Umrissen dem früheren Gebäude anglich. So wären der verzogene Grundriss und die damit entstehenden Unregelmäßigkeiten in der Gestaltung des Dachstuhls zu erklären. Es handelte sich offenbar nicht um eine neue Gesamtplanung, sondern man musste auf aufgegebene Grundstücksgrenzen und Mauerreste Rücksicht nehmen.
Im Laufe der Zeit wurde das Gebäude des 18. Jh. mehrmals umgebaut. Vor allem zu nennen wären hier die Baumaßnahmen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh., von denen noch die eingereichten Baupläne vorliegen. Diese Baupläne geben neben der Darstellung des geplanten Umbaus auch jeweils die vorgefundene Situation wieder, sodass noch heute ein Eindruck vom früheren Aussehen des Gebäudes gewonnen werden kann. So lässt sich festhalten, dass das Obergeschoss und das Dachgeschoss schon vor 1897 ausgebaut waren (DG) bzw. weitgehend ihre heutige Gestalt erhielten (OG). Das Erdgeschoss erhielt sein heutiges Aussehen bei dem Umbau von 1916, als ein Konfirmandensaal eingebaut wurde.
Später, um 1954, wurde im Westen noch die heutige Terrasse angebaut und um 1974 die Wandverkleidung des Pfarrsaals (Gemeindesaal) eingebracht. Insgesamt kann das Gebäude Metzgerstraße 56 als ein für Reutlingen historisch sehr bedeutsames Baudenkmal gelten, handelt es sich doch mit großer Wahrscheinlichkeit um das erste nach dem Stadtbrand von 1726 wiederrichtete Stadtpfarrhaus, das in dieser Funktion 1770 durch den Neubau des Gebäudes Aulberstraße 1 abgelöst wurde.
Das Haus Metzgerstraße 56 blieb weiterhin in kirchlicher Hand und Nutzung. Hervorzuheben ist trotz aller Veränderungen im Laufe der Jahrzehnte der Grundriss des 1. Obergeschosses, der in seiner heutigen Gestalt auf eine Umbauphase zurückgeht. Die Türgewände und Türblätter lassen den letzten größeren diesbezüglichen Umbau in die Zeit um 1800 bis zur 1. Hälfte des 19. Jh. datieren. Für den Grundriss wurde eine Gestaltung mit einer Enfilade gewählt, die in Frankreich entwickelt wurde und vor allem in repräsentativen Gebäuden zur Zeit des Barocks beliebt war.
(1726)
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Pfarrhaus
(1770)
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Rathaus
(1780)

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung
(1780 - 1781)
(1784 - 1785)
(1810)
(1813 - 1814)

- Ausstattung
(1897 - 1916)
(1917)
Eine allgemeine Beschreibung gibt die damals vorgefundenen Materialien wieder:
Umfassungswände: EG massiv aus Eninger Kalksteinen gemauert, darüber von ausgemauertem Fachwerk und verblendet.
Binnenwände: Von ausgeriegeltem Fachwerk.
Trauf- und Giebelgesims: Von Holz
Dach: Satteldach von braunglasierten Fachziegeln.
Zwerchhausaufbau mit glasierten Turmziegeln.
Auch die Treppen und weitere Einrichtungen, wie z.B. eine Sprechverbindung von Esszimmer des OG ins Studierzimmer werden beschrieben.
(1918)
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Untersuchung
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Wohnhaus
Zonierung:
Konstruktionen
- Dachform
- Satteldach
- Verwendete Materialien
- Putz