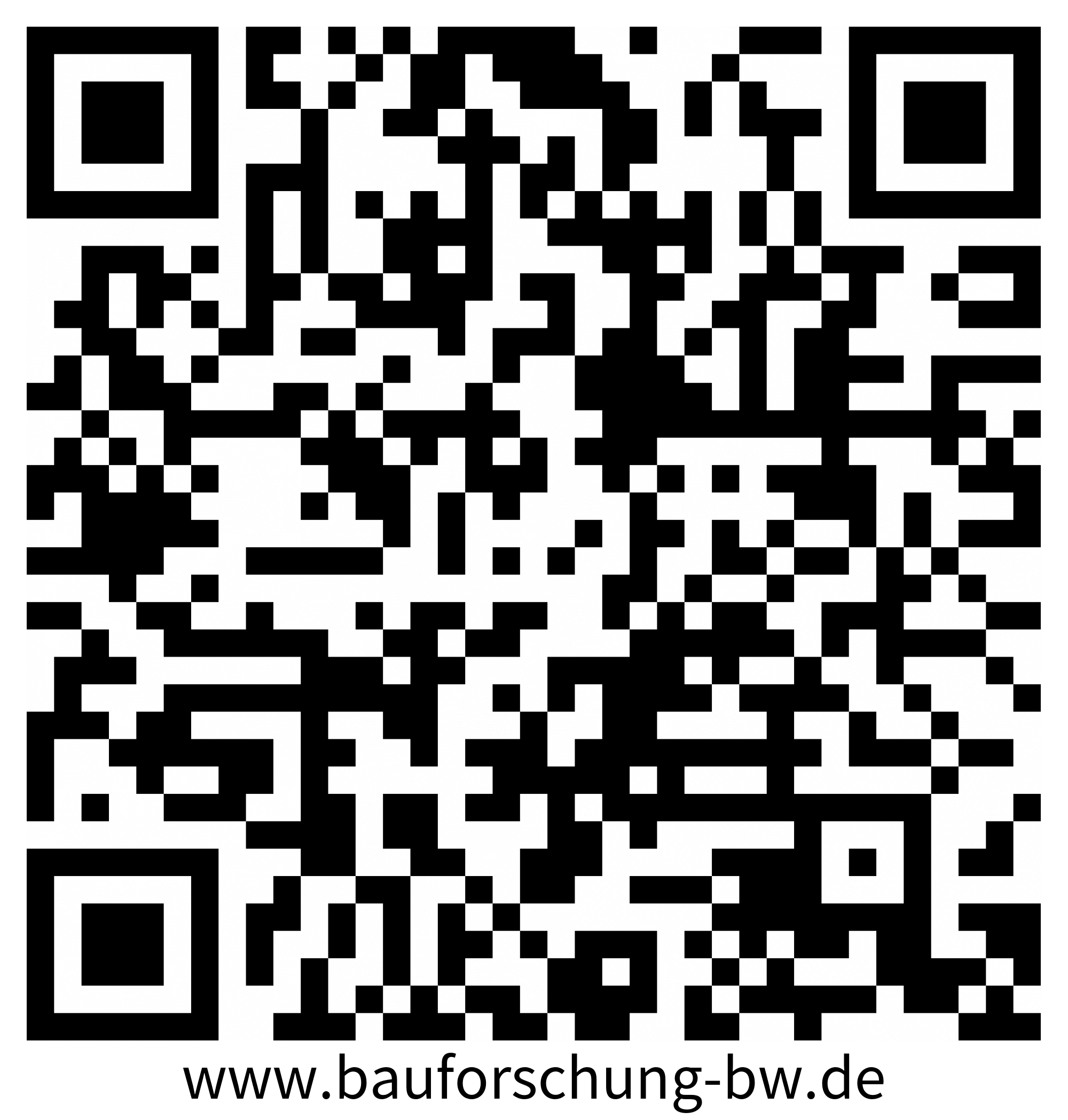Stiftsschaffneigebäude
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Friedrichstraße |
| Hausnummer: | 7 |
| Postleitzahl: | 77933 |
| Stadt-Teilort: | Lahr |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Ortenaukreis (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8317065013 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Evang. Stiftskirche, Bei der Stiftskirche 3 (77933 Lahr/Schwarzwald)
Christuskirche, Jammstraße 1 (77933 Lahr)
Gebäudekomplex, Kaiserstraße 20/22 (77933 Lahr)
Altes Rathaus, Kaiserstraße 1 (77933 Lahr)
Wohn- und Geschäftshaus, Kaiserstraße 37 (77933 Lahr)
Villa Imhausen und Park (77933 Lahr, Kaiserstraße 95)
Wohnhaus/Villa, Kaiserstraße 95 (77933 Lahr)
Wohnhaus, Kaiserstraße 30 (77933 Lahr)
Kath. Pfarrkirche Peter und Paul, Lotzbeckstraße 9 (77933 Lahr)
Sog. Storchenturm, Marktstraße 45 (77933 Lahr)
Kaserne (77933 Lahr, Neuwerkhof 8 und 10)
Bauphasen
Nach der baulichen Überlieferung ist der Kernbestand des Gebäudes in das 16. Jahrhundert zu datieren. Mit Ausnahme des Kellergewölbes, dessen Datierung in das 16. Jahrhundert letztlich nicht eindeutig gesichert ist, befinden sich die zugehörigen Baubefunde entlang der östlichen Rücktraufe und im rückwärtigen Giebelbereich, oberhalb der Dachbasis. Deutliche, in das 18. bzw. 19. Jahrhundert zu datierende Baubefunde, befinden sich im Südgiebel und entlang der Westtraufe.
Sofern das Gebäude im Jahre 1677 durch französische Truppen zerstört wurde und mehr als 60 Jahre nicht mehr nutzbar war, wurde es erst wieder im Jahre 1740 umgebaut bzw. in seiner Bausubstanz umfassend erneuert.
Eine weitere, die historische Bausubstanz betreffende Umbaumaßnahme datiert in das Jahr 1929, als zu diesem Zeitpunkt das alte Hochbauamt für den Lahrer Anzeiger umgenutzt wurde.
In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts erhielt das Gebäude seine heutige Funktion und wurde wieder zum städtischen Bürogebäude umgebaut.
(1500 - 1599)
(1677)
(1740)

- Dachgeschoss(e)
(1929)

- Ausstattung
(1950 - 1999)
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Bürogebäude
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Kurzuntersuchung
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Bürogebäude
Zonierung:
Konstruktionen
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
- Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.
- Stehende und geneigte Quer- und Längsbünde
- Dachform
- Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
- allgemein
Nach der dendrochronologischen Auswertung der entnommenen Bohrproben datiert das als Sparrendach konzipierte Dachwerk in das Jahr 1740 (d). Beginnend am Nordgiebel, wurden 33 Sparrendreiecke abgezimmert. Die Sparrenpaare zapfen in Dachbalken, deren Auflager die beiden massiven Traufwände bilden. Die Sparrenpaare werden durch insgesamt drei Kehlbalkenlagen stabilisiert. Letztere unterteilen die Dachhöhe in 4 Dachebenen.
Entsprechend den Dachprofilen werden die verschieden langen Kehlbalken durch unterschiedlich viele, in Firstrichtung verlaufende Längshölzer unterstützt.
Das 3. Dachgeschoss
Im 3. Dachgeschoss (Stockwerkzeichen: 3 Dreieckskerben) sind es zwei Längshölzer (Stuhlrähme), die als Bestandteile von zwei stehenden Längsbünden anzusprechen sind. Diese, die Kehlbalken unterstützenden Gerüsteinbauten durchziehen die gesamte Dachlänge und werden durch verzapfte Kopfstreben in Firstrichtung ausgesteift (Längsbünde, ein bzw. zwei Ruten).
Dadurch, dass die Gerüstständer der beiden Längsbünde in gemeinsamen Querachsen angeordnet sind und sowohl durch die Kehlbalken, als auch durch die verzapften Fuß- und Kopfstreben konstruktiv aufeinander abgestimmt sind, bilden sie insgesamt 7 Querbünde (Querachsen, ein bis sieben Ausstiche) aus, welche in der Kombination mit den Längsbünden ein zweifach stehendes Stuhlgerüst ergeben.
Bezogen auf die Lastabtragung der sich in den Querachsen sammelnden Dachlasten, führten diese in dem darunter liegenden Dachgeschoss zu keinen besonderen Anforderungen. Dazu waren die Kehlbalkenlängen zu kurz, um die aufgenommenen Lasten nicht in die Längshölzer darunter übertragen zu können.
Besondere Erwähnung verdient die Beobachtung, dass der Querbund (ein Ausstich) mit Abstand vor dem Giebel angeordnet wurde, während sich der Querbund (sieben Ausstiche) unmittelbar vor dem später aufgemauerten und verputzten Giebel befindet.
Dieser Befund deckt sich mit der Ausführung des Traufgesims, welches am rückwärtigen Giebel nahezu bündig mit diesem abschließt, aber am Südgiebel mit deutlichem Abstand vor dem Giebel endet.
Das 2. Dachgeschoss
Im 2. Dachgeschoss (Stockwerkzeichen: 2 Dreieckskerben) sind ebenfalls zwei Längshölzer verbaut. Im Gegensatz zum 3. Dachgeschoss sind sie nicht Bestandteile von stehenden, sondern von geneigten Längsbünden. Unter den Dachschrägen ausgeführt, bestehen deren tragende Ständer aus quer zur Firstrichtung ansteigende Bundstreben, die parallel zur Dachneigung verlaufend, die firstparallel ausgerichteten Rähme tragen. In welcher Form die beiden Längsbünde ausgesteift sind, war infolge der Dachverkleidung nicht erkennbar. Dies trifft auch auf die Gründung der Bundstreben zu.
Analog zum 3. Dachgeschoss bilden die Bundstreben der beiden Längsbünde gemeinsame Querachsen aus. Ausgesteift durch verzapfte Kopfstreben, bilden sie insgesamt sieben abgesprengte Querbünde aus, welche in der Kombination mit den geneigten Längsbünden eine zweifach liegende Stuhlkonstruktion ergeben.
Eine dieser Querachsen war offenbar in eine Fachwerkquerwand eingebunden, so dass diese Achse als belastende Achse für die Dachwerkebene darunter zu bewerten ist.
Eine besondere Erwähnung verdient der Befund, dass die Querbünde des 2. Dachgeschosses in vertikaler Abstimmung mit den oberen Querbünden angeordnet sind.
Das 1. Dachgeschoss
Im 1. Dachgeschoss (Stockwerkzeichen: 1 Dreieckskerbe) sind es drei, die gesamte Dachlänge durchziehende Längshölzer. Unter den Kehlbalken angeordnet, handelt es sich um die beiden liegenden Rähme der beiden unter den Dachschrägen abgezimmerten Längsbünde, während es sich innerhalb des Dachdreieckes um den mittigen Längsunterzug eines stehenden Längsbundes handelt. Die geneigten Längsbünde bestehen aus der liegenden Schwelle, zwei Riegelfolgen und dem liegenden Rähm, wobei in die Schwelle und das Rähm zapfende Streben die Längsaussteifung übernehmen. Getragen werden die Rähme durch Bundstreben, die gleichfalls in die Schwelle und das Rähm zapfend, auch konstruktiver Bestandteil von 7 Querbünden sind. Zwischen den Querbünden sind in den geneigten Längsbünden, zwischen Schwelle und Rähm, zusätzliche Bundstreben verbaut. Während die Bundstreben der Querbünde quer durch Kopfbüge ausgesteift werden bzw. waren, besitzen die zusätzlichen Streben keine Queraussteifung.
Wie schon im 2. Dachgeschoss ist davon auszugehen, dass die partiell erhaltene Fachwerkwand in Querachse (5 Ausstiche) als bauzeitlich einzuordnen ist, während der Raum vor dem Nordgiebel erst nach der Entfernung des Kopfbuges angelegt wurde.
Insgesamt handelt es sich um eine, für hohe Lasten ausgelegte Dachkonstruktion.
Besondere Erwähnung verdienen zwei Beobachtungen.
1.) Die Querbünde sind in vertikaler Anordnung mit den oberen Querbünden ausgeführt.
2.) Der mittige Längsbund erzeugt durch seine Ständer in jedem Querbund eine innere Lastabtragung, die in der Ebene darunter eine konstruktive Reaktion erfordert.
Beginnend im Osten sind alle in vertikaler Lage aufeinander abgestimmte Querbünde durch die steigende Folge von ein bis 7 Ausstiche gekennzeichnet.