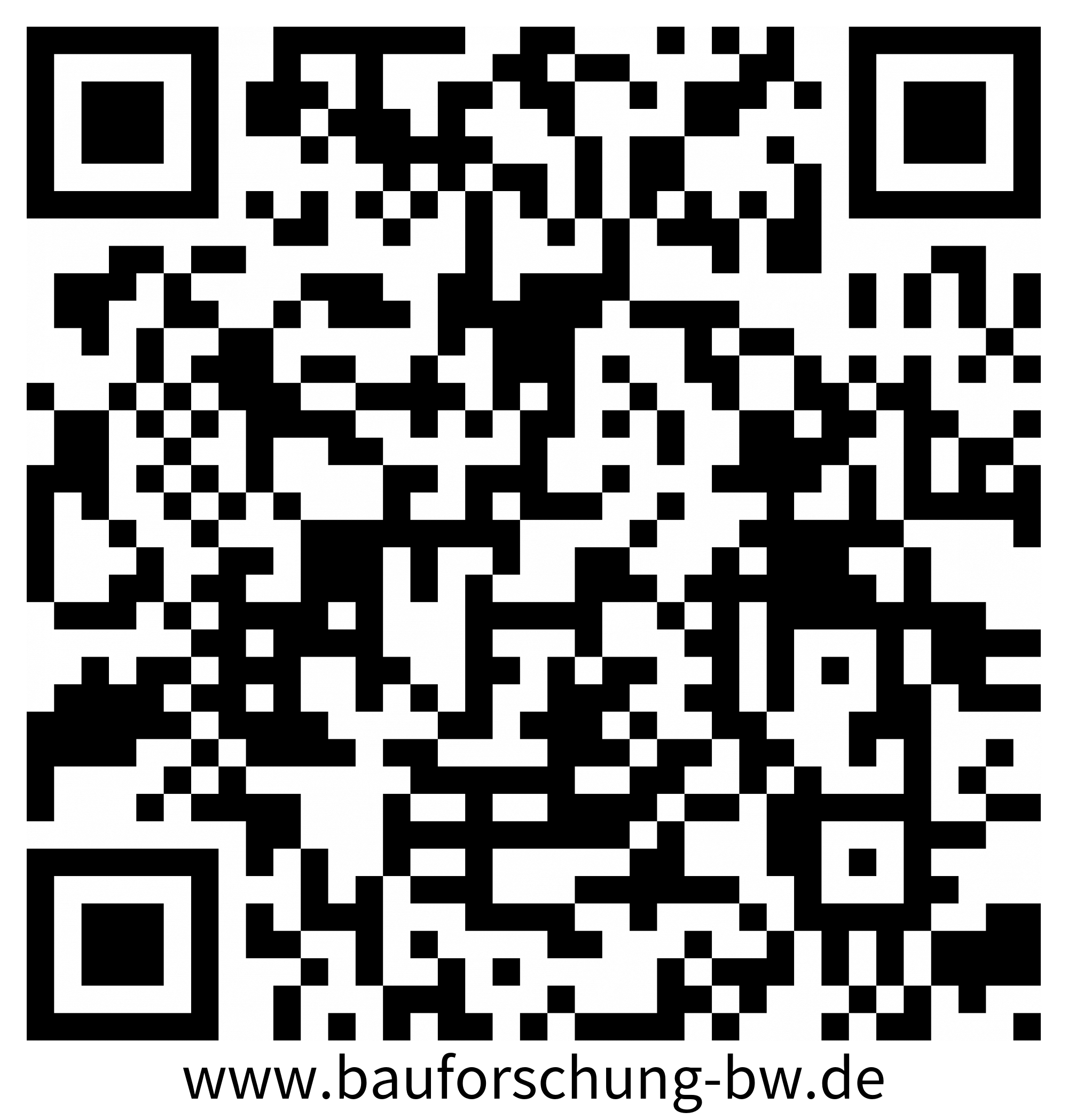Wohnhaus
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Burghof |
| Hausnummer: | 1 |
| Postleitzahl: | 89584 |
| Stadt-Teilort: | Ehingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Alb-Donau-Kreis (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8425033012 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Ehem. Heilig- Geist Spital, profanierte Kapelle, jetzt städt. Museum, Kasernengasse 2 (89584 Ehingen (Donau))
Rathaus (Turm), Marktplatz 1 (89584 Ehingen (Donau))
Ehem. Franziskanerkloster, Spitalstraße 30 (89584 Ehingen (Donau))
Brücke über die Schmiech, Bahnhofstraße (89584 Ehingen)
Abgegangenes Gebäude, Gymnasiumstraße 7 (89584 Ehingen)
Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstraße 21 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Hauptstraße 71 (89584 Ehingen)
Kolleg St. Josef (Altbau), Müllerstraße 8 (89584 Ehingen)
Ehem. Oberschaffnei, Schulgasse 21 (89584 Ehingen)
Teil der Stadtmauer , Schulgasse 21 (89584 Ehingen)
Abgegangenes Wohnhaus (Rest der Stadtmauer und Gewölbekeller), Schwanengasse 18 (89584 Ehingen)
Stadtmauerreste (89584 Ehingen, Schwanengasse 22, 26, 28)
Stadtmauerrest, Schwanengasse 26, Schwanengasse 26 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Tränkberg 4 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Tuchergasse 40 (89584 Ehingen)
Bauphasen
Der dreigeschossige Massivbau stammt im Kern aus der Mitte des 16. Jahrhundert. Der Bau wird von stadtgeschichtlicher Seite mit dem Ehinger Burg- bzw. Schlossbezirk in Zusammenhang gebracht. Baumaßnahmen um 1554 würden dann auf den damaligen Pfandherren Konrad von Bemmelberg zurückgehen, wobei eine weitergehende Einordnung auf archivalischer Grundlage bislang nicht möglich ist. Die weitere Geschichte des Gebäudes scheint unbekannt zu sein, bis es 1840 vom Staat erworben und in der Folgezeit als Oberamtsarrest diente. Während sich im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Wohnungen von Vollzugsbeamten befanden, nahmen das zweite Obergeschoss und das erste Dachgeschoss Gefängniszellen auf. Diese Nutzung ist von 1841 bis 1947 belegt. Bis 1951 waren die Fenster der oberen Geschosse noch vergittert. ln der Folgezeit wurde der Bau als Wohngebäude genutzt und in den oberen Geschossen dementsprechend verändert.
(1554)

- Dachgeschoss(e)
(1841 - 1947)
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Gefängnis
(1951)
- Wohnbauten
- Wohnhaus
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Untersuchung
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Wohnhaus
Zonierung:
Konstruktionen
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
- Verwendete Materialien
- Backstein
- Steinbau Mauerwerk
- allgemein
Zur ursprünglichen lnnengliederung von Erdgeschoss und Obergeschossen geben heute nur noch die Reste der ursprünglichen Befensterung Aufschluss. lm Erdgeschoß weisen die zahlreichen Fensternischen mit verputzten und gefasten Laibungen darauf hin, dass sich hier keine große Halle für Wirtschafts- oder Lagerzwecke befand, sondern dass das Geschoss zu Wohn- oder Verwaltungszwecken ausgebaut war. Wenn am südlichen Ende der Ostseite ursprüngliche eine große, sehr breite Fensternische vorhanden war, so dürfte sich in der Südostecke einst eine Stube befunden haben. Die kleineren Fenster an der Nordseite weisen darauf hin, dass sich im nördlichen Teil der Grundfläche Räume von eher untergeordneter Bedeutung befunden haben werden. Diese Differenzierung macht eine kleinteilige Untergliederung der Grundfläche wahrscheinlich, die sich heute aber nicht mehr im Einzelnen nachvollziehen lässt. Den Hauszugang wird man - da entsprechende Öffnungen an Süd-, Ost- und Nordseite nicht vorhanden sind - vermutlich im mittleren oder südlichen Bereich der Westseite suchen dürfen, und es ist denkbar, dass sich von hier aus ein Mittelflur bis zur Ostseite des Gebäudes zog, entlang dessen nord- und südseitig verschiedene Einzelräume gereiht waren. Hinweise auf Art und Lage einer ursprünglichen Treppenanlage sind nicht vorhanden. lm ersten Obergeschoss belegen uns die beiden großen Fensternischen im südlichen und nördlichen Abschnitt der Ostwand, dass sich in der Südostecke der Geschossfläche einst eine große Stube befand. An der spärlicher belichteten Nordseite dürften sich wiederum Räume von untergeordneter Nutzung befunden haben, während wir ansonsten über die weitere Grundrissgliederung nicht genauer informiert sind. Ähnliches gilt auch für das zweite Obergeschoss. Hier weisen die meisten Räume nur recht kleine Fenster auf, ohne dass sich aus der Fensteranordnung weitergehende Schlüsse zur Grundrissgliederung ziehen ließen. Eindeutiger ist die Situation hingegen im Kellerbereich, in der zu jener Zeil der heutige Gewölbekeller von Osten her erschlossen war, sowie im Dachbereich, in dem uns Hinweise auf einen ursprünglichen Ausbau fehlen. Die Ausführung des Gebäudes als Massivbau, das Fehlen von Wirtschafts-, Lager- oder Gewerberäumen im Erdgeschoss und das Vorhandensein der sehr großen Stube im ersten Obergeschoss machen eine Zuordnung des Gebäudes zum herrschaftlichen Bauwesen wahrscheinlich. Den nur wenigen Farb- und Putzschichten zufolge scheint der ursprüngliche Bau keine intensive Nutzung und zunächst kaum größere Veränderungen oder Renovierungen erfahren zu haben. Am Baubestand lässt sich an einzelnen Stellen eine Zwischenphase nachweisen, in der einzelne Fensteröffnungen vermauert oder verändert wurden, ohne dass wir jedoch über Zeitstellung und Umfang der Maßnahmen näher informiert wären. Die zweite wichtige Bauphase des Gebäudes datiert dann in das 19. Jahrhundert und fällt offensichtlich mit dem Umbau zum Oberamtsgefängnis kurz nach 1840 zusammen. Die Fälldaten des Deckengebälkes im Hausunterbau verweisen darauf, dass die diesbezüglichen Umbauten im Jahr 1848, allenfalls unmittelbar danach, ausgeführt wurden. Damals wurde das gesamte Innere von Erdgeschoss und Obergeschossen erneuert, wobei die älteren Innenwände und Decken komplett entfernt wurden. In allen Geschossen wurden dann neue Deckenbalkenlagen und neue Innenwände eingezogen. lm Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss entstanden die heute noch weitgehend unverändert erhaltenen Wohn- und Verwaltungsräume, während das zweite Obergeschoss mit Zellen ausgebaut wurde. Diese reihten sich entlang eines Mittelflures, der von der Ost- bis zur Westseite durchlief. Ebenfalls neu entstand die heutige Treppenanlage mit dem westseitigen Vorbau, in dem die Treppenpodeste ihren Platz fanden. Der Keller wurde nun durch eine Innentreppe vom Eingangsflur aus erschlossen, während das erste Dachgeschoss ebenfalls mit Zellen und Nebenräumen ausgebaut wurde. Hier lagen entlang der östlichen Giebelseite zunächst drei Zellen, auf die der schmale Querflur und westseitig Treppenflur und zwei Nebenräume folgten. Lediglich der obere Teil des Dachraumes blieb von größeren Veränderungen verschont. Soweit erkennbar, wurde das Gebäude damals auch komplett neu befenstert und vollflächig neu verputzt.
Eine letzte größere Umbauphase wird dann mit der Aufgabe der Gefängnisnutzung im 20. Jahrhundert greifbar. Damals wurden das zweite Obergeschoss und das erste Dachgeschoss für Wohnzwecke umgebaut. lm zweiten Obergeschoss wurde der einst durchgehende Mittelflur zugunsten eines großen südöstlichen Eckraumes aufgegeben, während im ersten Dachgeschoss eine Zellentrennwand entfernt wurde, um hinter der östlichen Giebelscheibe auch einen größeren Raum zu gewinnen. Ebenfalls in jene Zeit fallen einzelne punktuelle Veränderungen wie die Erneuerung der Treppenanlage im Erdgeschossbereich sowie die Erneuerung von Türen und Fenstern in großen Teilen des Gebäudes. Eingriffe in die Substanz des 16. Jahrhunderts scheinen damals nicht stattgefunden zu haben, so dass sich die Reste der Ursprungszeit des Gebäudes damals nicht weiter verringert haben.
Insgesamt ist uns damit im Gebäude Burghof 1 in Ehingen ein Steinbau des 16. Jahrhundert in Kelleranlage, Außenmauerwerk und Dachwerk mit einem im mittleren 19. Jahrhundert vollständig erneuerten Innenausbau und einer im 19. und 20. Jahrhundert gewachsenen Außenerscheinung
überliefert.