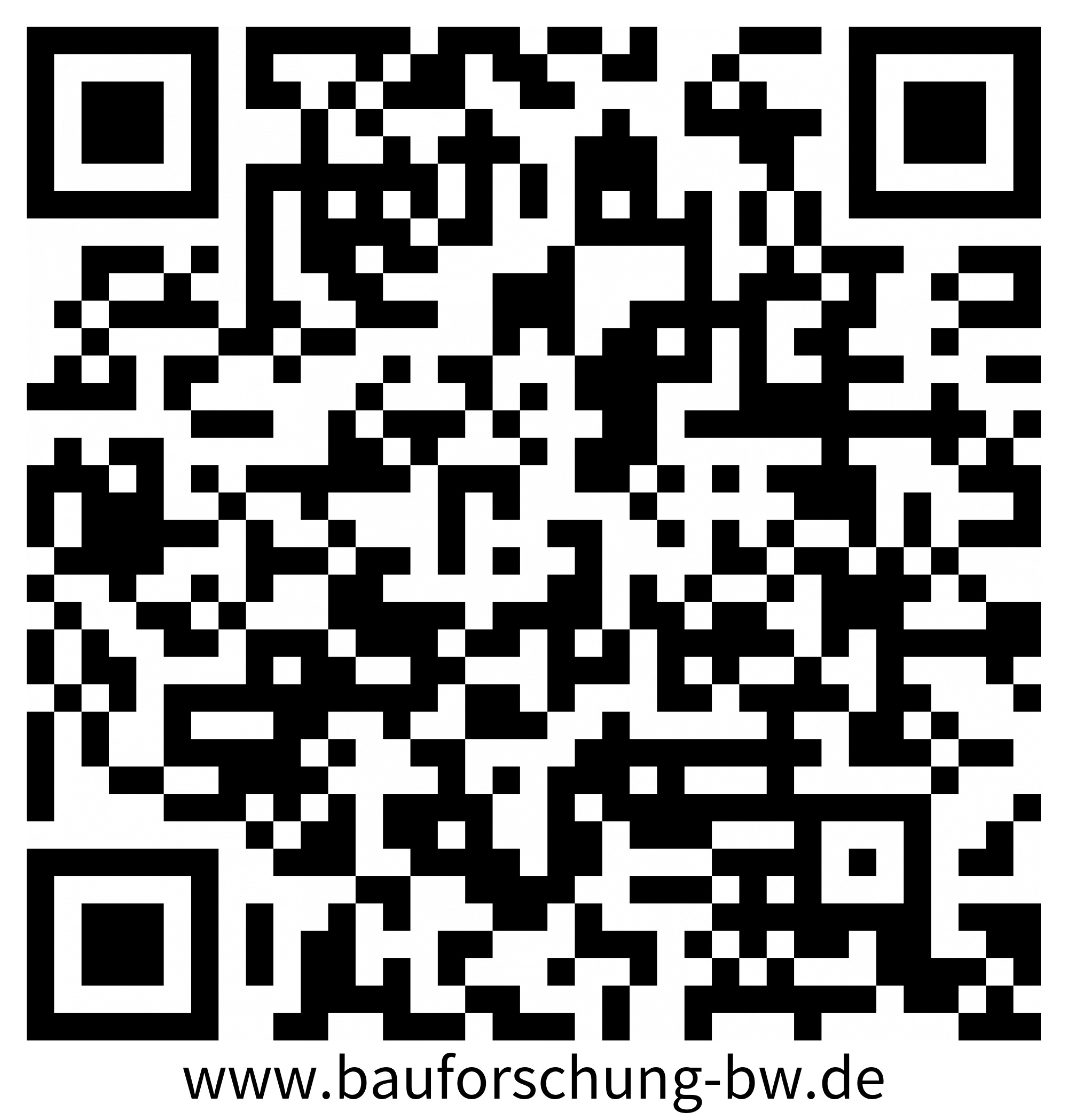Ehem. Seelhaus, heute Museum
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Spitalplatz |
| Hausnummer: | 1 |
| Postleitzahl: | 73441 |
| Stadt-Teilort: | Bopfingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ostalbkreis (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8136010005 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Steinhaus, ehem. Stadthaus des Klosters Neresheim (73441 Bopfingen, Härtsfeld 35)
Altes Rathaus (73441 Bopfingen, Marktplatz 1)
Ehemaliges Amtshaus, Bopfingen (Bopfingen, Marktplatz 1)
Wohnhaus, Marktplatz 3 (73441 Bopfingen, Marktplatz 3)
Bauphasen
Aus dem Jahre 1444 stammt eine Erwähnung über das "Seelhaus" "in der Seelgasse", in welchem die "Seelfrauen oder Seeltöchter" wohnten. Die Gemeinschaft der Seelfrauen unterstand einem aus den Reihen der Ratsherren gewählten Pfleger. Geld- und Grundbesitzstiftungen oder aber die Entlohnung ihrer Arbeit ermöglichten über Jahrhunderte unter anderem die Kranken- und Seelenpflege an Armen und Reichen. Nach dem 30jährigen Krieg soll das Gebäude unter der Leitung eines Verwalterehepaares von vereinsamten, armen Frauen und Männern bewohnt worden sein. Die Pfleger haben bis ins 18. Jahrhundert Geld ausgeliehen und Stiftungen angenommen, bis die Hospital- und Armenpflege der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg zum Opfer fiel.(a)
Die Auswertung der dendrochronologische Untersuchung ergab, dass die Errichtung des Gebäudes im Verlaufe des Jahres 1505 (d) anzunehmen ist. Bei dem untersuchten Gebäude handelt es sich um einen Nachfolgebau des im Jahre 1444 erwähnten Seelhauses. Dass es an der gleichen Stelle wie sein Vorgängerbau errichtet wurde, ist unbestimmt, aber anzunehmen. Abgesehen von der Neugestaltung der Stubendecke im Jahre 1548 (d) und der Verkleidung der Stubenwände durch Wandbretter hat das Haus über einen Zeitraum von über 300 Jahren keine gravierende Veränderung erfahren. 1816 (d) erfolgen wesentlich Ein- und Umbauten. 1880 (d) wird der Einbau von Kaminen und die Vergrößerung der Fenster an der Südtraufe vorgenommen. Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg erhielten die nördlichen Zimmer und die alte Küche einen neuen Kamin. Zeitgleich wurde das Dach ausgebaut. Um 1990 wurde das Gebäude saniert. Heute ist hier das städtische Museum untergebracht.
(aus : Bopfingen. Freie Reichsstadt, Mittelpunkt des württbg. Rieses, Konrad Theiss Verlag Stuttgart und Aalen 1971)
(1505)
Aus dem Kerngerüst des Hauses wurden insgesamt acht Holzproben entnommen. Die Auswertung ergab, dass die Errichtung des Gebäudes im Verlaufe des Jahres 1505 (d) anzunehmen ist. Bei dem untersuchten Gebäude handelt es sich um einen Nachfolgebau des im Jahre 1444 erwähnten Seelhauses. Dass es an der gleichen Stelle wie sein Vorgängerbau errichtet wurde, ist unbestimmt, aber anzunehmen.
Nach Fertigstellung des Gebäudes wohnten im ersten Oberstock mehrere Personen in einem gemeinschaftlichen Wohnverhältnis. Der private Bereich erstreckte sich auf Einzelzimmer mit einer mittleren Wohnfläche von ca. 10,5 qm. Die Räume sind von einem zentralen Flur erschlossen. Die Türen waren von innen verschließbar. Belichtet wurden die einzelnen Räume durch eine Fensteröffnung von ca. 37 x 110 cm. Keiner der Räume war beheizbar. Nach Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, dass die Fensteröffnungen nur mit einem Laden zu verschließen waren. Eine Decken- bzw. Bodenisolierung war nicht vorhanden. Der Boden- und Deckenaufbau bestand aus einer ca. 3,5 cm starken Dielung. Die verriegelten Flechtwerkwände mit Stroh-Lehm-Auftrag wurden in Sichtfachwerk ausgeführt. Untersuchungen belegen, dass die Hölzer graugrün gestrichen waren, die gekalkten Gefache sich durch zwei schwarze, in den Ecken überkreuzende Begleitstriche absetzten.
Für alle Bewohner war eine Küche vorhanden. Hier wurde das gemeinsame Essen zubereitet. Von der Küche wurde über eine Hinterladeröffnung der Ofen in der Stube gefeuert. Durch ein Rauchrückzugsloch in der Trennwand zur Stube gelang der Rauch vom Ofen zurück in die Küche. Herd- und Ofenrauch wurden in einen Kamin über das Dach geleitet. Der Kamin saß auf den Dachbalken auf. Aussagen über das Baumaterial sind nicht möglich. Die Küche war rauchgeschwärzt. Rauchfrei war hingegen die Stube. Mit über 45 qm war sie der größte Raum im Oberstock. Die Umfassungswände waren in Bruchstein ausgeführt und innen graugrün gestrichen. Der Boden war durch einen Blindboden isoliert. Eine niedrige Decke, in der Regel mit einem Lehmauftrag auf der Oberseite, verriegelte das zu erwärmende Raumvolumen und isolierte nach oben. Mit seiner Größe erfüllte der Raum alle Anforderungen eines gemeinsamen Aufenthaltsraumes. Hier konnte gegessen, gearbeitet, kommuniziert und in kalten Nächten eine Schlafstelle am Kachelofen gefunden werden. Ein gemeinsames Klo befand sich an der Nordtraufe zum Hof hinaus.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind durch eingehende Untersuchungen detaillierte Angaben über den Wechsel von Wohnkomfort und Wohnen über einen Zeitraum von mehr als 400 Jahren möglich. Die zeitlichen Fixpunkte der eingetretenen Veränderungen basieren auf dendrochronologischen Untersuchungen der in diesem Zusammenhang neu eingebauten Hölzer.

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
(1548)
Abgesehen von der Neugestaltung der Stubendecke im Jahre 1548 (d) und der Verkleidung der Stubenwände durch Wandbretter hat das Haus über einen Zeitraum von über 300 Jahren keine gravierende Veränderung erfahren.

- Erdgeschoss
- Ausstattung
(1816)
Die erste wesentliche Um- und Einbauten datieren in das Jahr 1816 (d). Zu diesem Zeitpunkt wird die Küche eingewölbt und das Ziegelgewölbe mit zwei Rauchabzugslöchern versehen. Die Trennwand zur Stube erhält eine neue Hinterladeröffnung. Die Nebentüre im Unterstock wird geschlossen. Der ehemalige Treppenaufgang im Oberstock wird dem benachbarten Raum zugeordnet, der nun in Angrenzung an die Küche ebenfalls eine Heizvorrichtung erhält. Zusätzlich werden an der Nordtraufe zwei größere Fensteröffnungen eingebaut. Von der "Großen Stube" wird eine Kammer abgetrennt. In beiden Räumen werden neue Decken eingezogen. Das Haus erhält einen modernen Hauseingang, großzügigere Treppenaufgänge und einen neuen Flurbelag mit Ziegelplatten. Der Westgiebel wird bis zum First massiv gestaltet, das gesamte Haus mit einem Außenputz versehen. Die mittige Ständerreihe im Unterstock wird entfernt. Zusätzlich neben dem alten Unterzug werden zwei neue Längshölzer verlegt. Diese dreifache Abfangung wird durch Mauerpfeiler und Wandscheiben unterstützt.
Der veränderte Grundriss zeigt in zweifacher Weise eine differenzierte Sozialstruktur unter den Bewohnern an. Die "Große Stube", unterteilt in Stube und Kammer, bildet von nun an eine abgesonderte Wohneinheit. Als Ersatz für die "Große Stube" dient nun die "Kleine Stube". Allem Anschein nach spiegelt sich hier der in den Quellen aufgeführte Einzug eines Verwalterehepaares wieder. Lediglich die Küche wird weiterhin gemeinsam genutzt.

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung
(1880)
Eine kleine Unsicherheit besteht für diese Umbauphase, in der die südlichen Räume mit dreieckigen Kaminen ausgestattet und die Fenster an der Südtraufe vergrößert werden. Über die geräumigen, vom Flur begehbaren Kamine, werden durch Hinterladeröffnungen die Öfen befeuert. Diese besitzen nun Ofenrohre, durch die der Rauch über der Kopfhöhe des Heizers in den Kamin geleitet wird. Die Kamine sitzen auf dem Gebälk über Unterstock auf. Die oben angesprochene Unsicherheit ergibt sich daraus, dass die im Jahre 1816 (d) zusätzlich eingebauten Unterzüge im Unterstock wohl am ehesten mit den erhöhten Lasten durch die Kamine in Verbindung zu bringen sind. Da aber der Ziegelverband von Kamin- und Flurwandbereich eine Einheit bildet, ist an den Kaminbauten im Jahre 1880 eigentlich nicht zu zweifeln. Auch die Vergrößerung der Südfenster im Zusammenhang mit der Erwärmung der Zimmer kann aus den Baubefunden erschlossen werden. So zeigt z.B. der Fensterstiel des ostwärtigen Zimmers ein Abbundzeichen, das dieses Holz als ehemaliger Flurwandriegel im Bereich der neuen Tür ausweist.
Die nächste jüngere Veränderung ist nicht datiert. Sie konnte nur anhand von nachträglich geschlossenen Ofenrohrlöchern in den Flurwänden erfasst werden. Das Fehlen von Kaminen zeigt, dass die nördlichen Räume in dieser Zeit durch das Aufstellen von Vorderladeröfen erwärmt werden konnten. Bis zur letzten hier vorgestellten Umbauphase wird diese fortschrittliche Heiztechnik als Zwischenlösung bezeichnet.

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung
(1918)
Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg erhielten auch die nördlichen Zimmer einen eigenen und die alte Küche einen neuen Kamin. Diese Kamine reichen vom Erdboden bis über das Dach. Die Vorderladeröfen sind nun in fast allen Zimmern aufgestellt. Zu diesem Zeitpunkt, als auch das Dach ausgebaut und zum Teil mit separaten Kaminen ausgestattet wurde, herrschte noch die alte Befeuerungstechnik über die Hinterladeröffnung vor.
Die Aufgabe der Hospital- und Armenpflege ist anhand der schriftlichen Quellen nach dem Ersten Weltkrieg anzusetzen. Ab diesem Zeitpunkt diente das Haus den unterschiedlichsten Zwecken. Den danach eingetretenen Nutzungsänderungen soll an dieser Stelle nicht weiter nachgegangen werden.

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung
(1946)
Dass zuvor noch die alte Befeuerungstechnik über die Hinterladeröffnung vorherrschte, zeigt der Kamin in der südlichen Kammer. Als Untergrund für einen Putzauftrag, mit dem die Hinterladeröffnung geschlossen wurde, diente eine Zeitung. Leider war das Datum nicht erhalten. Da ein Artikel von dem beschlossenen Auszug der amerikanischen Besatzungstruppen am Rhein handelt, ist die Schließung dieser Öffnung wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg anzusetzen.

- Erdgeschoss
(1990)
Das Gebäude ist inzwischen behutsam saniert und dient nun als städtisches Museum.

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Siedlung
- Stadt
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Museum/Ausstellungsgebäude
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Untersuchung
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Museum/Ausstellungsgebäude
Zonierung:
Vom Treppenhaus führt eine Tür mit Spitzbogen in die Küche. Hier konnten Hinweise auf eine Rauchfangabfangung sowie auf die Rauchfangöffnung am verrußten Deckengebälk, in Anlehnung an die westliche Trennwand, aufgenommen werden. Innerhalb der Bruchsteintrennwand zum westlich benachbarten Raum ist die ursprüngliche Hinterladeröffnung, über die ein Ofen im angrenzenden Raum von der Küche aus befeuert wurde, zu vermuten.
Die Grundrissanordnung im ersten Oberstock zeigt die Aufreihung einzelner Wohnräume für ca. 7-10 Personen, deren hauswirtschaftliches Zentrum die gemeinsame Küche und die "Große Stube" war. Neben der Aufnahme von Einzelzimmern für die Bewohner diente das Gebäude der Lagerung von Vorräten oder sonstiger Güter im Dach sowie der Viehhaltung im Unterstock. Dass die Bewohner die dadurch anfallenden Arbeiten selbst verrichteten und sich zum Teil davon ernährten, ist anzunehmen.
Konstruktionen
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
- Bruchstein/Wacken
- Flechtwerk
- Steinbau Mauerwerk
- Bruchstein
- Mischbau
- Obergeschoss(e) aus Holz
- Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Dachform
- Satteldach
- Decken
- Balken-Bretter-Decke
Reste eines Bodenaufbaus wurden teilweise im ostwärtigen Teil des Hausgrundrisses freigelegt. Dabei handelt es sich um eine Pflasterung von ca. faustgroßem Steinmaterial. Zwei parallel zum First verlaufende Ziegelrinnen unterteilen die Hausbreite in zwei äußere Nutzungsflächen mit Gefälle zur Gebäudemitte. Die beiden Ziegelrinnen begrenzen eine Art mittigen Gang von ca. 1,30 m Breite, der mit den Rinnen leicht nach Osten abfällt. Das Gebälk zwischen den Querachsen 1 und 2 ist ausgewechselt. Der Bundbalken ist erhalten. In Anlehnung an die südliche Traufe, im Bereich des heutigen Hauseingangs, besitzt er eine Streifnut für die Aufnahme eines Treppenlochwechsels.
Hinsichtlich der Frage nach der ursprünglichen Erschließung des Gebäudes ist vorerst von den Befunden an der nördlichen Traufseite auszugehen. Hier führt die oben angesprochene Türöffnung zu einem Treppenaufgang, der anhand des beschriebenen Befundes wohl durch zwei seitliche Bretterwände vom eigentlichen Unterstock abgetrennt war. In Verbindung mit der zu überwindenden Raumhöhe (sie beträgt ca. 2,95 m), der zur Verfügung stehenden Treppenlauflänge sowie durch die beidseitige Abtrennung handelt es sich um eine äußerst steile, schlauchartig abgetrennte Nebentreppe als direkter Aufgang zum Oberstock oder von hier hinunter zum Hof. Eine in Ziegel gefasste Öffnung an der nördlichen Oberstocktraufe belichtete den Treppenaufgang. Die Lage der eigentlichen Hauserschließung ist an der südlichen Traufe zu vermuten. Gestützt wird dies unter anderem durch den hier vorhandenen, aber weitaus jüngeren Hauseingang. Die Streifnut am Bundbalken der ersten inneren Querachse ist als Hinweis auf eine ältere Treppenöffnung an dieser Stelle zu deuten. Bedingt durch die Höhe des Unterstocks wird ein abgewinkelter Treppenlauf angenommen, der durch die großzügige Grundrisskonzeption an dieser Stelle auch möglich ist. Zu bemerken ist in diesem Zusammenhang die Anlage eines Doppelfensters im ersten Oberstock sowie eine eigenartige runde Vertiefung von 10 cm mit einem Durchmesser von 5 cm am mittigen Fensterständer.
Durch die Toreinfahrt an der nördlichen Traufe war der rückwärtige gepflasterte Hausteil zu erreichen. Die Pflasterung und die angetroffenen Ziegelrinnen legen eine landwirtschaftliche Nutzung dieses Hausteiles nahe. Am ehesten ist dabei an die Aufstallung von Vieh zu denken. Vom übrigen Hausgrundriss war dieser Hausteil wohl durch eine Querwand in Anlehnung an die Toreinfahrt abgetrennt. Ein sicherer Nachweis für eine derartige Abtrennung konnte jedoch nicht geführt werden. Hinweise sind lediglich durch die konstruktive Gerüstausbildung des Unterstocks gegeben. Diese wird geprägt durch die mittige, firstparallele über die gesamte Hauslänge reichende Stützenreihe. Zumindest über die drei westlichen Zonen ist durch die kopfzonige Aussteifung dieser Holzständer in vier Richtungen ein freier hohler Raum angedeutet. Mit der dritten Innenquerachse wechselt die Aussteifungsart der Ständer, was wohl mit der Anlage einer Trennwand in Zusammenhang zu bringen ist.
Auf dem massiven Unterbau ist ein einstöckiges Fachwerkgerüst aufgeschlagen. Der überdurchschnittlich hohe Originalbestand lässt die Gerüst- und Gefügeausbildung klar erkennen, sodass zum größten Teil keine näheren Erläuterungen nötig sind: Das Sichtfachwerk war außen farblich gehalten. Nach den Untersuchungen des Restaurators war das Holzwerk in einem gebrannten Siena-Rot gestrichen. Die gekalkten Putzfelder waren mit zwei schwarzen Begleitstrichen, die sich an den Enden überkreuzten, abgesetzt. Das tragende Gerüst besteht aus stockwerkhohen Ständern die sowohl innerhalb der Trennwände wie auch im Zuge der Innenwände auf Schwellhölzern stehen. Der Dielenboden ist außen nicht sichtbar. Zu beachten sind die verschiedenen Variationen der Gefügeanordnung und deren Ausbildung. So sind z.B. die Fußaussteifungen an der Nordtraufe mit der Schwelle überblattet und an der Südseite in die Schwelle eingezapft. Eine ähnliche Variationsbreite bietet die innere Gerüstaussteifung. Hier wurden innerhalb der Querachsen neben angeblatteten Kopf- und Fußbändern hauptsächlich wandhohe verzapfte Streben eingebaut. Weitgehend original erhalten ist der Westgiebel. Aussagen zur ehemaligen Fachwerkgestaltung des Ostgiebels sind infolge eines nachträglichen Massivgiebels kaum noch möglich. Sicher ist, dass er über dem Unterstock mit Stichgebälk auskragte und danach, im Gegensatz zum Westgiebel, als Steilgiebel ausgeführt war. Innerhalb der inneren Längsachsen wurde weitgehend auf eine Gerüstaussteifung verzichtet. Nur an exponierten Stellen (Treppenabgängen) unterbrechen die Schräghölzer die waagrechte und senkrechte Gliederung der Fachwerkwände. Der Wandaufbau zwischen den Ständern ist nicht einheitlich. Die Untersuchung ergab, dass die Wände der westlichen Zone mit Bruchstein geschlossen waren. Alle übrigen Wände besaßen eine Flechtwerkfüllung. Mit Ausnahme der nördlichen Traufwandhälfte zwischen Zone 1 und 2 waren alle Wände zweifach verriegelt.
Die ursprüngliche Raumaufteilung einschließlich der Fenster- und Türöffnungen ist zu einem hohen Maß original erhalten bzw. durch die entsprechenden Zapfenlöcher der jetzt fehlenden Tür- und Fensterstiele eindeutig rekonstruierbar. Der Grundriss des Fachwerkoberstockes wird geprägt durch eine mittige, firstparallel verlaufende Fluranlage. Dieser Flur war einerseits durch die Nebentreppe wie auch durch den Hauptzugang und von hier über ein geräumiges Treppenhaus erreichbar. Entlang des Flures reihen sich beidseitig je fünf Räume von zum Teil unterschiedlicher Größe auf. Am ostwärtigen Giebel ist nach Norden ein Gang zum ehemals traufseitig überhängenden WC abgetrennt. Vom Treppenhaus führt eine Tür mit Spitzbogen in die Küche. Hier konnten Hinweise auf eine Rauchfangabfangung sowie auf die Rauchfangöffnung am verrußten Deckengebälk, in Anlehnung an die westliche Trennwand, aufgenommen werden. Innerhalb der Bruchsteintrennwand zum westlich benachbarten Raum ist die ursprüngliche Hinterladeröffnung, über die ein Ofen im angrenzenden Raum von der Küche aus befeuert wurde, zu vermuten. Jüngere Einbauten haben die Spuren verwischt. Die erhaltenen Traufständer der Südfassade innerhalb der ersten Zone besitzen eine senkrechte Nut von 7 cm Breite und 5 cm Tiefe. Zusätzlich besitzt der die Zone begrenzende Ständer eine zweite Nut zur Gebäudemitte. Der benachbarte Ständer innerhalb dieser Querachse besitzt jedoch keine Nut. Zwischen den Traufständern ist ein Sturzriegel (b=25 cm, h=16 cm) eingebaut. Innen ist der Riegel in seiner gesamten Länge auf 2/3 der Höhe um ca. 3 cm auf einer Breite von 23 cm reduziert. Zapfenlöcher zeigen die Fortsetzung der Verriegelung zum Giebel hin an. Zwischen Brust- und Sturzriegel ist eine kleine Öffnung im Bruchsteinmauerwerk freigelassen. Auf einem, vor die Wandscheibe verlegten Balken lagert eine profilierte Bretter-Balken-Decke. Sie reicht ca. 2 cm in das Gebäude und ist dort abgesägt. Eine originale Unterteilung des giebelseitigen Großraumes konnte nicht erkannt werden. Auf den beschriebenen Raum ist in jeglicher Hinsicht das Hauptinteresse zu lenken. Folgende Befunde weisen ihn als das wohnliche Zentrum des gesamten Gebäudes aus: Er ist mit Abstand der größte Raum. Mit seiner Lage zur Gasse nimmt er die repräsentativste Lage ein. Die Ständerstellung an der Südtraufe erlaubt die Anlage eines geräumigen Fensters und damit den freien und direkten Blick die Gasse entlang. Er besaß einen Ofen und war rauchfrei (die Küche besaß nur den offenen Herd). Die Umfassungswände waren in Bruchstein ausgeführt und innen graugrün gestrichen. (Die Nuten dienten zum Einbringen der Riegel, nicht für den Einbau von Bohlen.) Der Raum besaß allem Anschein nach schon seit dem Jahre 1505 eine Bretter-Balken-Decke unter dem Dachgebälk. (Die angetroffene Bretter-Balken-Decke ist dendrochronologisch auf das Jahr 1538 datiert und damit möglicherweise als Ersatz einer älteren Decke anzusehen. Hinweise auf eine Unterstützung der großen Spannweite von Traufe zu Traufe konnten nicht erkannt werden.) Es war der einzige Raum, der zum Unterstock mit einem Blindboden isoliert war. In Anlehnung an die Größe wird dieser Raum als die "Große Stube" bezeichnet.
Das Dachgerüst besteht aus liegenden Bindern deren Stuhlständer in einer Länge über zwei Dachgeschosse reichen. Die Aussteifung der liegenden Stühle erfolgt in der Querrichtung durch angeblattete Kopfbänder sowie durch gezapfte Spannriegel und Kehlbalken. In der Längsausrichtung erfolgt die Aussteifung durch geschoßübergreifende Andreaskreuze zwischen den Bindern und innerhalb der Dachneigung. Die Sparren sind in die Dachbalken eingezapft. Am Firstpunkt sind sie untereinander verschlitzt. In den Dachraum führte eine abgewinkelte Treppe. Anzeichen für diese Treppe sind neben den Zapfenlöchern in den Riegeln (zur Aufnahme eines Treppenpodestes) auch durch die Dachbalkenabstände gegeben. Während der Abstand der Balken zwischen 65 und 70 cm liegt, beträgt er in Anlehnung an die zweite Trennwand 90 cm. Eine kleine Öffnung an der Südtraufe belichtet den Treppenlauf. Der Dachraum war ungeteilt. Rückschlüsse für eine Spindelverankerung an den westlichen Kehlbalken zeigen an, dass über eine ehemalige Ladeluke im Giebeldreieck Lagergut eingeholt werden konnte. Über die Art des Materials sind keine Aussagen möglich.