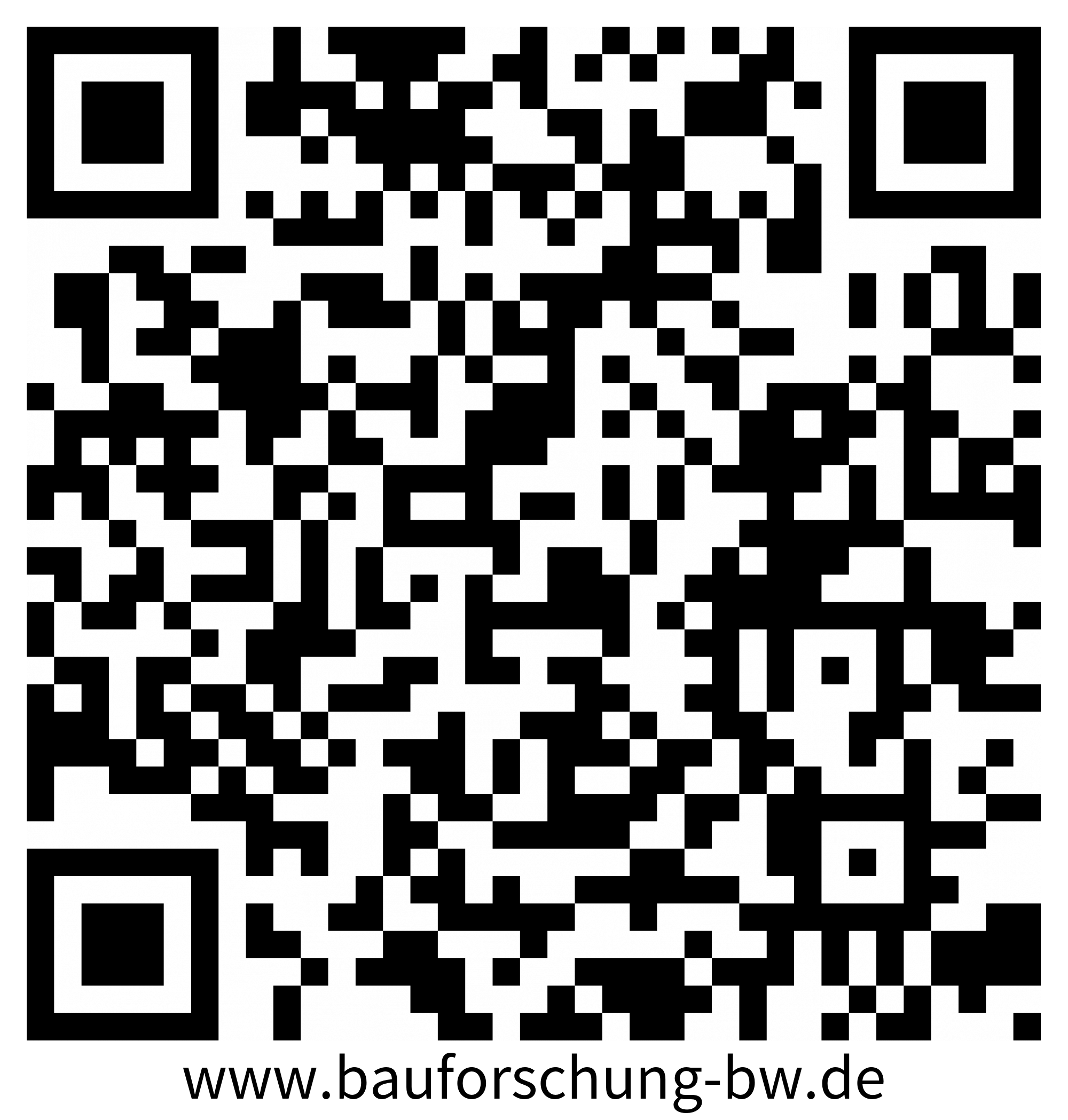Wohngebäude
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Hauptstraße |
| Hausnummer: | 25 |
| Postleitzahl: | 73344 |
| Stadt-Teilort: | Gruibingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Göppingen (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8117028001 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Bauphasen
Das Gebäude Hauptstraße 25 in Gruibingen wurde 1668 neu erbaut. Bemerkenswert sind dabei zwei Punkte:
1. wurden die unterschiedlichsten und sehr untypische Holzarten (Apfel, Esche) für die Fachwerkkonstruktion verwendet und 2. wurden die Hölzer im Sommer und nicht wie normalerweise üblich im Winter gefällt. Diese beiden Punkte sprechen dafür, dass der Aufbau des Gebäudes sehr rasch vollzogen werden musste und zugleich eine gewisse Holznot bestand. Man konnte also nicht bis zum Winter warten und fällte alle schnell "greifbaren" Baumarten.
Solche Vorgehensweisen sind typisch nach Zerstörungen von Orten bzw. nach Dorfbränden. Und tatsächlich ist für den 20. März 1668 urkundlich belegt, dass durch die Unvorsichtigkeit eines Schmieds ein Feuer in Gruibingen ausbrach, das in anderthalb Stunden das ganze Dorf, mit Ausnahme der Kirche, des Pfarrhauses, des Fruchtkastens und eines einzigen Bauernhauses, vernichtete. Somit ist verständlich, dass die Dorfbevölkerung im Sommer 1668 bemüht war, Gruibingen möglichst schnell wieder aufzubauen und jedes Bauholz gut genug war, um so rasch wie möglich wieder "ein Dach über dem Kopf" zu haben.
(1668)

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Siedlung
- Dorf
- Wohnbauten
- Wohnhaus
Zugeordnete Dokumentationen
- Dendrochronologische Untersuchung
Beschreibung
giebelständigen Wohngebäuden.
- Siedlung
- Dorf
- Wohnbauten
- Wohnhaus
Nach oben schließt das Gebäude mit zwei Dachgeschossebenen unter einem Satteldach ab. Das 1. Dachgeschoss stößt giebelseitig leicht über dem Erdgeschoss vor. An der westlichen Traufseite befindet sich ein kleiner Backofen-Anbau.
Zonierung:
drei Querzonen und zwei Längszonen ab. Die mittlere Querzone nimmt die Erschließung des Gebäudes (Flur/Treppenhaus) auf. In der nördlichen Querzone (zur Straße hin) findet sich die
ehemalige Stube und Stubenkammer. Die südliche Querzone nimmt untergeordnete Kammern auf.
Die beiden Dachgeschossebenen sind unausgebaut und dienten zu Lagerzwecken. Im 1. Dachgeschoss zeichnet sich ebenfalls eine Grundrissgliederung mit drei Querzonen ab.
Konstruktionen
- Dachform
- Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Decken
- Balkendecke
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
- Holzgerüstbau
- Geschossgerüst
Diese Zeichen zeigen eine durchgängige Zählung der Bundachsen von 1 bis 4. Somit kann von einer einheitlichen, zeitgleichen Errichtung des Dachtragwerks ausgegangen werden. Lediglich in der südlichen Dachhälfte wurden nachträglich die Stuhlrähme erneuert und damit möglicherweise auch einige Sparren und Kehlbalken ausgetauscht. Daher wurden die Proben zur dendrochronologischen Untersuchung überwiegend in der nördlichen Dachhälfte entnommen. Das historische Dachtragwerk zeigt eine deutliche Rußschwärzung, die auf ein ehemaliges Rauchdach (ohne Kamin über Dach) hinweist. Die Gefache bestehen im Dachgeschoss noch weitestgehend aus bauzeitlichem Lehmflechtwerk. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass hier unterschiedlichste Holzarten verbaut wurden. Zum Einsatz kamen neben Buchen auch Eschen, Pappeln und sogar Apfelbaum.