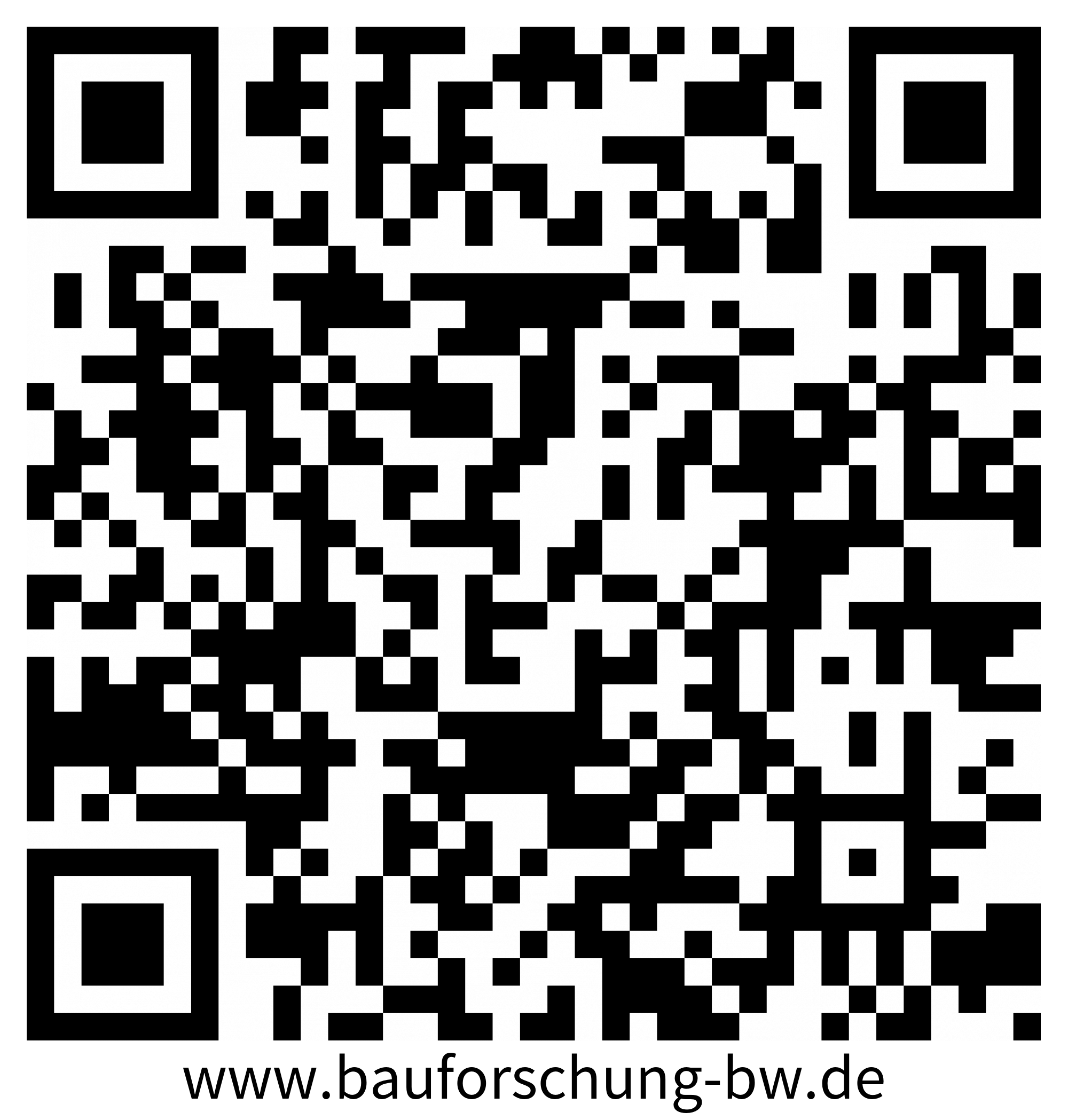Gasthof Ochsen
ID:
186532409017
/
Datum:
27.06.2012
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Hauptstraße |
| Hausnummer: | 37 |
| Postleitzahl: | 71093 |
| Stadt-Teilort: | Weil im Schönbuch |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Böblingen (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8115051008 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Durch Ihre Cookie-Auswahl haben Sie die Kartenansicht deaktiviert, die eigentlich hier angezeigt werden würde. Wenn Sie die Kartenansicht nutzen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen unter Impressum & Datenschutzerklärung an.
Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:
Eine bauhistorische Befunderhebung fand im Rahmen dieses dendrochronologischen Datierungsberichts nicht statt. Daher stützen sich die bauhistorischen Anmerkungen auf Beobachtungen während der ca. einstündigen Begehung bei der Entnahme der Dendrobohrkerne.
1. Bauphase:
(1469 - 1470)
(1469 - 1470)
Ältester Gebäudeteil von 1469/70 (d):
Im Zwischengeschoss über dem östlichen EG konnte eine Deckenbalkenlage mit zwei Längsunterzügen beobachtet werden, die erhebliche Verrußungen aufweisen. Vergleichbare Verrußungen finden sich im DG nicht.
In der westlich an das Treppenhaus anschließenden Fachwerkwand war zudem punktuell ein Ständer mit einer Blattsasse zu beobachten. Der konstruktive Zusammenhang war nicht einsehbar.
Die einheitliche Verrußung legt nahe, dass es sich hier nicht um zweitverwendete Hölzer handelt, sondern dass sich im EG und 1. OG zumindest in Resten ein älterer Kernbau erhalten hat. Da die historische Bausubstanz hier allerdings im 20. Jahrhundert stark überformt und ersetzt worden ist, lässt sich der Umfang und Erhaltungsgrad dieses älteren Kernbaus ohne umfangreiche Sondagen nicht ermitteln.
Im Zwischengeschoss über dem östlichen EG konnte eine Deckenbalkenlage mit zwei Längsunterzügen beobachtet werden, die erhebliche Verrußungen aufweisen. Vergleichbare Verrußungen finden sich im DG nicht.
In der westlich an das Treppenhaus anschließenden Fachwerkwand war zudem punktuell ein Ständer mit einer Blattsasse zu beobachten. Der konstruktive Zusammenhang war nicht einsehbar.
Die einheitliche Verrußung legt nahe, dass es sich hier nicht um zweitverwendete Hölzer handelt, sondern dass sich im EG und 1. OG zumindest in Resten ein älterer Kernbau erhalten hat. Da die historische Bausubstanz hier allerdings im 20. Jahrhundert stark überformt und ersetzt worden ist, lässt sich der Umfang und Erhaltungsgrad dieses älteren Kernbaus ohne umfangreiche Sondagen nicht ermitteln.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
2. Bauphase:
(1707)
(1707)
Umbau von 1707:
Der Umbau in ein barockes Gasthausgebäude von 1707 (d) hat sich im 2. OG und im Dach weitgehend erhalten. Die dreischiffige Anlage der östlichen Stubenzone dürfte bauzeitlich datieren. An die Stubenzone schloss eine Flurküchenzone über die gesamte Hausbreite an. Die heutige Küchenlängswand ist nicht bauzeitlich. An die Küchenzone schlossen bauzeitlich zwei Kammerzonen nach Westen an, die von einem Mittellängsflur aus erschlossen sind. Dieser vierzonige Grundriss ist auch im Dachstuhl des 1. und 2. DG noch vorhanden.
Der Umbau in ein barockes Gasthausgebäude von 1707 (d) hat sich im 2. OG und im Dach weitgehend erhalten. Die dreischiffige Anlage der östlichen Stubenzone dürfte bauzeitlich datieren. An die Stubenzone schloss eine Flurküchenzone über die gesamte Hausbreite an. Die heutige Küchenlängswand ist nicht bauzeitlich. An die Küchenzone schlossen bauzeitlich zwei Kammerzonen nach Westen an, die von einem Mittellängsflur aus erschlossen sind. Dieser vierzonige Grundriss ist auch im Dachstuhl des 1. und 2. DG noch vorhanden.
Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
3. Bauphase:
(1750 - 1850)
(1750 - 1850)
Als Umbauten des späten 18. oder frühen 19. Jahrhunderts sind die Zwischenwände im 1. DG zu nennen, die von dem ursprünglich völlig offenen Dachraum vier Kammern abtrennten. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurde wohl auch die Westgiebelwand erneuert. Außerdem wurde im 2. OG der südliche Teil der Flurküchenzone vom Flur abgetrennt.
Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
4. Bauphase:
(1900 - 1999)
(1900 - 1999)
Die umfangreichen Umbauten im EG und 1. OG datieren vermutlich bereits ins 20. Jahrhundert. Zu nennen sind hier der Einbau einer Metzgerei samt neuer Unterkellerung und vermutlich die Verlegung der Gaststätte vom OG in die Westhälfte des EG. Es ist fraglich, in wie weit sich in diesen Bereichen überhaupt noch historische Bausubstanz erhalten hat. Mehr Aufschluss über diese Baumaßnahmen könnte eine Archivalienauswertung bringen.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
Zugeordnete Dokumentationen
- Dendrochronologische Datierung
Beschreibung
Umgebung, Lage:
Das ehemalige Gasthaus Ochsen steht in der Ortsmitte von Weil im Schönbuch, traufständig an der Hauptstraße. Der östliche Fachwerkziergiebel mit dem barocken Zierfachwerk zeigt zur heutigen Metzgergasse.
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Der Riegelbau mit Satteldach und Halbwalm auf der Ostseite erhebt sich über einem sich trapezförmig nach Westen verjüngenden Grundriss.
Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:
Zonierung:
In den unteren Geschossen ist das Gebäude etwa mittig quer unterteilt und in der HÖhe differenziert: Die östliche Hälfte ist mit einem flach gedeckten Kellergeschoss versehen, über dem ein hohes Erdgeschoss folgt. Die ursprüngliche Decke zum 2. OG ist etwa 1,2 m tiefer durch eine Betondecke des 20. Jahrhunderts abgehängt. Dadurch entsteht auf der Obergeschossebene ein nicht nutzbares niedriges Zwischengeschoss.
In der westlichen Haushälfte befinden sich im nicht unterkellerten und tiefer liegenden Erdgeschoss die Gaststättenräume. Im 1. OG befinden sich hier Wohnräume. Ab dem 2. OG befindet sich die ganze Hausfläche wieder auf einer einheitlichen Höhenlage.
Die Grundrissgliederung im UG, EG und 1. OG ist unregelmäßig, was in erster Linie auf die umfangreichen Umbauten des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist.
Im 2. OG hat sich die Grundrissstruktur mit einer aus drei Räumen bestehenden Stubenzone im Osten, einer Flurzone mit abgetrennter Küche und westlich zwei Kammerzonen mit einem Mittellängsflur besser erhalten.
In der westlichen Haushälfte befinden sich im nicht unterkellerten und tiefer liegenden Erdgeschoss die Gaststättenräume. Im 1. OG befinden sich hier Wohnräume. Ab dem 2. OG befindet sich die ganze Hausfläche wieder auf einer einheitlichen Höhenlage.
Die Grundrissgliederung im UG, EG und 1. OG ist unregelmäßig, was in erster Linie auf die umfangreichen Umbauten des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist.
Im 2. OG hat sich die Grundrissstruktur mit einer aus drei Räumen bestehenden Stubenzone im Osten, einer Flurzone mit abgetrennter Küche und westlich zwei Kammerzonen mit einem Mittellängsflur besser erhalten.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Im unteren Teil ist das Baugefüge zudem durch die substanzzehrenden Umbauten des 20. Jahrhunderts dezimiert; der Abbruch des Gebäudes ist vorgesehen.
Bestand/Ausstattung:
Im 2. OG und im DG haben sich Türen aus dem späten 18. Jahrhundert, ein Lambris und mehrere schlichte Stuckdecken erhalten.
Konstruktionen
Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachform
- Satteldach
- Schopfwalm (Krüppelwalm)
Konstruktion/Material:
Im Bereich des UG, EG und 1. OG konnten keine Holzwände (mehr?) beobachtet werden. Die heutigen massiven Wände sind allerdings vermutlich auf Umbauten des 20. Jahrhunderts zurückzuführen. Das 2. OG ist dagegen aus Fachwerk errichtet, das überwiegend verputzt ist.
Der Dachstuhl ist im 1. DG als zweifach liegender Stuhl mit mittigem stehendem Stuhl ausgebildet. Auffällig ist die zu den Mittelständern hin abfallende Anordnung der Spannriegel an den Querbünden. Im 2. DG hingegen ist nur ein zweifach liegender Stuhl ausgebildet.
Der Dachstuhl ist im 1. DG als zweifach liegender Stuhl mit mittigem stehendem Stuhl ausgebildet. Auffällig ist die zu den Mittelständern hin abfallende Anordnung der Spannriegel an den Querbünden. Im 2. DG hingegen ist nur ein zweifach liegender Stuhl ausgebildet.