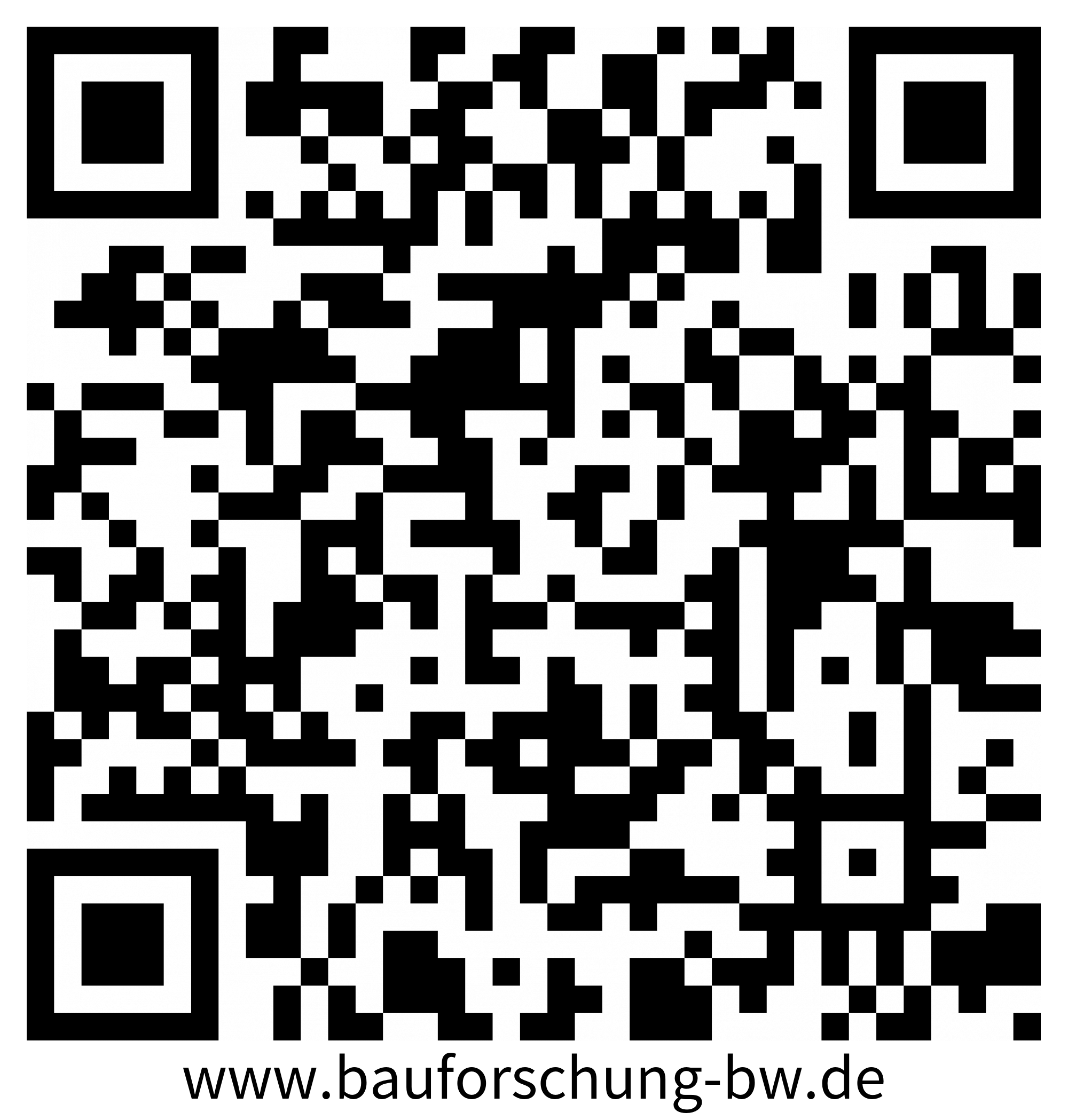Gasthaus zum Rößle
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Grundstraße |
| Hausnummer: | 2 |
| Postleitzahl: | 78661 |
| Stadt-Teilort: | Dietingen-Rotenzimmern |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Rottweil (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8325011010 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Bauernhaus, Täbinger Straße 15 (78661 Dietingen-Rotenzimmern)
Wohnhaus, Täbinger Straße 9 (78661 Dietingen-Rotenzimmern)
Friedhofsmauer, Gösslinger Straße 12 (78661 Rotenzimmern)
Bauphasen
Der Kernbau wurde im Jahr 1759 (i, d) errichtet, was das Ergebnis der dendrochronologischen Untersuchung und die Inschrift am steinernen Bogen der Haustür belegen: 17 H · I · S H 59 (Initialen des Wirts Hans Iacob S[c]hwartz).
Teile der Erdgeschosswände bzw. der dortige Kellerraum könnten zu einem Vorgängerbau gehören.
Im Jahr 1822 (i) wurde der Anbau angefügt, zumindest ist eine entsprechende Inschrift am Sturzholz des Gewölbekellers des rückwärtigen Anbaus zu lesen: H I · 1 8 2 2 · S W (1782 bis 1868 war der Gasthof im Besitz der Familie Schwenk). In der Urkarte zum Flurkataster von 1837 ist der Anbau verzeichnet.
Um 1952/53 (Baugesuch datiert 1952) erfolgte die Erweiterung des Anbaus und diverse Innenausbauten. In den 1960er Jahren wurden weitere Grundrissveränderungen v. a. im Bereich des Saales im Anbau und im Wirtschaftsteil des Kernbaus vorgenommen.
(0 - 1759)

- Erdgeschoss
- Siedlung
- Dorf
(1759)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Siedlung
- Dorf
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
(1822)

- Anbau
- Siedlung
- Dorf
(1900 - 1939)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
(1920 - 1930)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Anbau
- Siedlung
- Dorf
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
(1952 - 1953)
Wohl gleichzeitig Ausbau der nördlichen Dachkammer im 1. Dachgeschoss des Kernbaus. Kamin ersetzt. Ein Fenster in der Giebelwand zugemauert, ein zweites durch ein größeres Fenster ersetzt. Brandhemmende Trennwand im Dachbereich zwischen zweiter und dritter Querzone. Einbau einer Zwischendecke im hinteren Teil der Tenne.

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Anbau
- Siedlung
- Dorf
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus
(1960 - 1969)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Anbau
- Siedlung
- Dorf
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Analyse
Beschreibung
- Siedlung
- Dorf
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
Zonierung:
Die Hauptwohnräume wurden im Obergeschoss innerhalb der ersten drei Querzonen untergebracht: Stuben/ Küche, Flur, Kammern. Davon ist die erste Querzone am Vordergiebel zugleich die breiteste und die anschließende für den Querflur die schmalste. An der zu Straße und Ortsmitte gerichteten südöstlichen Ecke liegt die große Stube, die sich über die beiden ersten Querzonen ausdehnt und wohl seit der Bauzeit als Gaststube diente (Ortschronik; Quellensammlung). Daran schließen die Küche und neben dieser in der hinteren Ecklage ein weiterer kleinerer Stubenraum an. Von der Küche konnten die Öfen beider Stubenräume beschickt werden. Die dritte Querzone nahm drei Kammern auf.
Im Erdgeschoss liegt ein durchlaufender Querflur mit Haustür und Treppe in der schmalen zweiten Zone. Die erster Querzone am Giebel nimmt aktuell ein Lager- und Vorratsraum mit Zugangstüren in Flurwand und vorderer Traufwand sowie ein Gewölbekeller ein. Flur und vorderer Abschnitt könnten ursprünglich einen großen Raum gebildet haben oder es bestand eine Wand, die durch die aktuelle Fachflurwand.
In der dritten Querzone befand sich ursprünglich ein Stall. Der Zugang lag unmittelbar neben der Hauseingangstür und hatte dieselbe Form und Größe (heute Schopftor). Die vierte Querzone wird von der hohen, über beide Geschosse reichenden Tenne (zugl. Futtergang) mit einem Tor in entsprechender Breite und Höhe an der vorderen Traufseite eingenommen.
Für den übrigen Bereich westlich der Tenne, der zuletzt als Stall diente, reichen die Baubefunde lediglich zur Rekonstruktion einer Querwand aus, die ihn in zwei Querzonen teilte (zweiter Stall oder Schopf).
Das Heulager in den letzten beiden Querzonen im Obergeschoss setzt sich in den Dachraum fort, indem das Dachgebälk mit Ausnahme der Querbinderachse ausgespart ist. Der Bereich des 1. Dachgeschosses oberhalb von Tenne und dritter Querzone diente als Lagerfläche, ebenso das 2. Dachgeschoss.
Im 1. Dachgeschoss ist wiederum ein Querflur ausgebildet und die erste Querzone mittig in zwei Dachkammern geteilt. Die Wand jenseits der Flurzone trennt zwischen Wohn- und Wirtschaftsteil, enthält aber eine Türöffnung.
Der rückwärtige Anbau war anfangs sehr viel schmaler als er es heute ist. Im Erdgeschoss
nimmt er einen kleinen Gewölbekeller und einen etwas größeren Raum auf. Beides ist von einem schmalen Gang her zugänglich, welcher in Verlängerung des Querflurs des Kernbaus liegt, aber nur dessen halbe Breite umfasst.
Das Obergeschoss des Anbaus war anfangs ebenfalls in einen schmalen Flur, der den Querflur des Kernbaus verlängerte, ein kleinerer Raum im Anschluss an den Kernbau und einen etwas größeren giebelseitigen Raum unterteilt.
Beide Stuben weisen Kassettendecken und Wandtäfer auf, das der hinteren Stube wohl noch weitgehend im ursprünglichen Zustand.
Konstruktionen
- Mischbau
- Obergeschoss(e) aus Holz
- Dachform
- Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
- Quader
Im Erdgeschoss des Kernbaus finden sich zwei gewölbte Kellerräume, sodass ein Untergeschoss nicht besteht. Das Erdgeschoss besitzt gemauerte Umfassungs- und teilweise auch Innenwände, während Obergeschoss und Dachwerk als Holzkonstruktion errichtet worden sind.
Im Obergeschoss sind alle Außen- und Innenwände Teil eines zusammenhängenden Holzgerüsts, bestehend aus einem Ständergerüst und Fachwerkfüllungen mit zweifacher Verriegelung und Feldstreben. Die Längsrähme lassen auf ganzer Länge keine Stöße erkennen. Die Dachbalken kragen traufseitig vor, wo ihre Kanten gefast sind.
Mit Ausnahme der rückwärtigen Giebelwand sind die Gefache ausgemauert. An der Rücktraufe hat sich unter dem späteren Anbau auf Höhe des Obergeschosses die ursprüngliche Wandgestaltung mit ungefasten Hölzern und weiß getünchtem Glattputz auf den Gefachen erhalten. An den Innenflächen von Heulager und Tenne wurde hingegen lediglich der Mauermörtel verstrichen. Der Außenputz wurde mehrfach erneuert.
Das Dachwerk ist als Sparrendach mit eingestelltem Stuhl gebildet. Die sieben Querbinderachsen, die sich aus den sechs Querzonen ergeben, sind in unterschiedlicher Weise aufgebaut. Die beiden Giebelwände und die beiden hintersten inneren Querbinder jenseits der Tenne sind als dreifach stehender Stuhl, die übrigen drei inneren Querbünde diesseits der Tenne sind als liegender Stuhl mit mittig stehender Achse abgezimmert. Dies trifft für beide Dachgeschosse zu, wobei aber der liegende Stuhl des 1. Dachgeschosses auf einer Stuhlschwelle gründet und die Längsaussteifung aus sich überkreuzenden Fuß- und Feldstreben zusammengesetzt ist, wogegen im 2. Dachgeschoss auf eine solche Schwelle verzichtet wurde, sodass die Längsaussteifung nur aus langen Kopfstreben, teilweise ebenfalls überkreuzt, bestehen kann.
Im Erdgeschoss des Anbaus sind die Umfassungswände aus größeren, recht sauber versetzten und ausgezwickten Sandsteinquadern gefügt worden. Der Gewölbekeller besitzt eine Vorsatzmauer entlang des Kernbaus, dem das Gewölbe aufsitzt.
Im Obergeschoss des Anbaus haben sich die aus Fachwerk gebildeten Wände auf Ost- und Nordseite weitgehend erhalten, und sie sind in ihrem ursprünglichen Aufbau vollständig nachvollziehbar, während für die verlorene Westwand keine gesicherten Angaben möglich sind.
Die beiden äußeren Längsachsen der bestehenden Dachkonstruktion des Anbaus rühren vom früheren Dachwerk her. Dort bildeten sie einst einen stehenden Stuhl mit Kopfstreben in Längs- und Querrichtung. Die Abbundzeichensystematik ist in der üblichen Weise aus eingeschnittenen Römischen Ziffern und Zusatzzeichen aufgebaut. Der Bezugsachsenschnittpunkt liegt an der Südostecke.