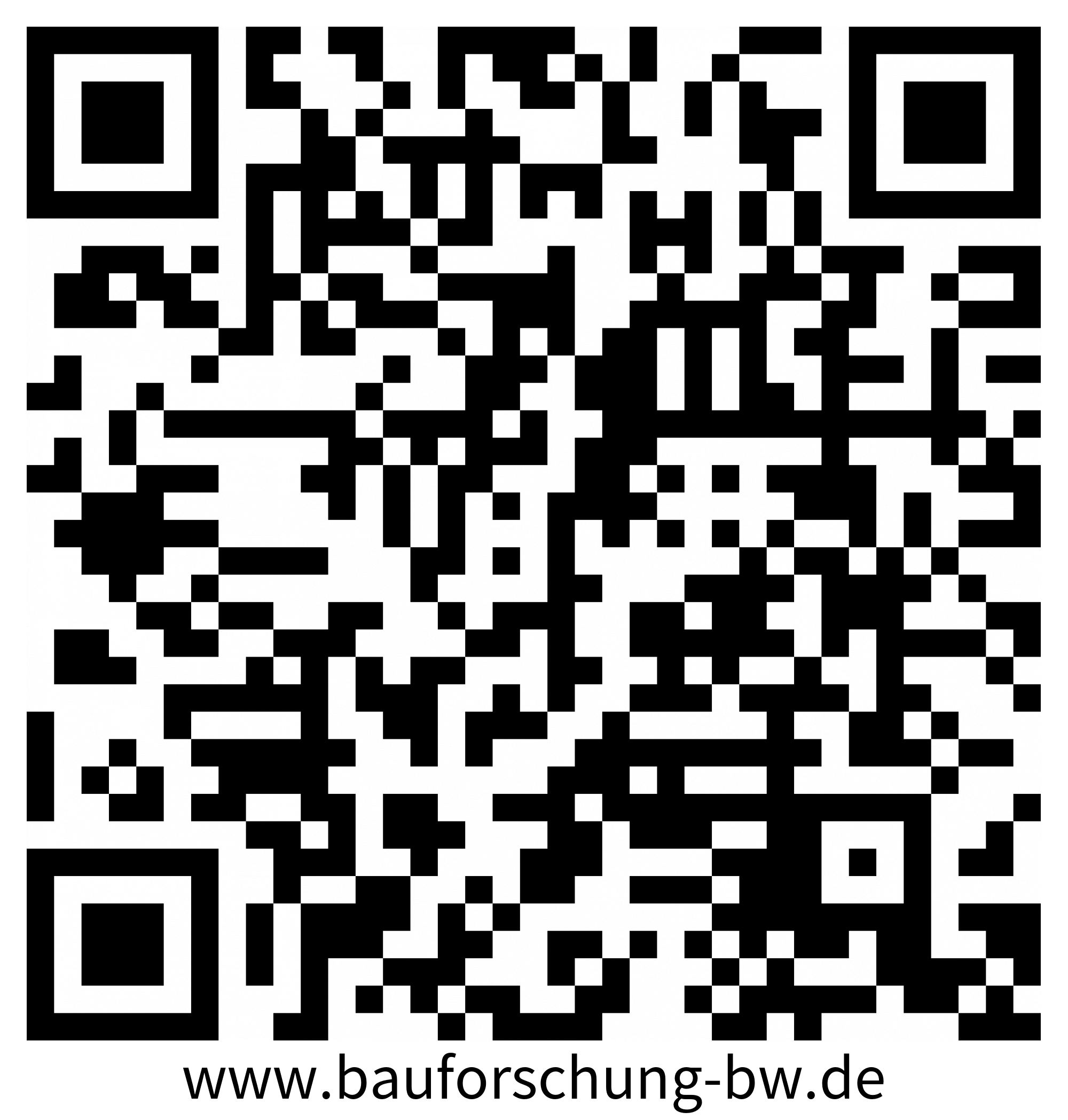Reichsabtei Gutenzell
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Schlossbezirk |
| Hausnummer: | keine |
| Postleitzahl: | 88484 |
| Stadt-Teilort: | Gutenzell-Hürbel |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Biberach (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8426135005 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Objektbeziehungen
| Ist Gebäudeteil von: | |
| keine Angabe | |
|
|
|
| Besteht aus folgenden Gebäudeteilen: | |
| 1. Beinhaltet Bauteil: | Ehem. Kanlzei des Oberamtmannes, Schloßbezirk 5 |
Friedhofskapelle Hl. Kreuz, Auf dem Kapellenberg 1 (88484 Gutenzell)
Kath. Kirche St. Cosmas und Damian, Schlossbezirk 9 (88484 Gutenzell)
Bauphasen
Das Kloster Gutenzell wird zum ersten Mal im Jahre 1238 urkundlich erwähnt als ihm von Papst Gregor IX. die Ordensprivilegien der Zisterzienser bestätigt werden, zu deren Regeln sich die Gemeinschaft wohl bereits ein Jahr vorher bekannt hatte. In dieser Urkunde wird bereits eine Äbtissin genannt, weshalb davon auszugehen ist, dass der Konvent schon deutlich früher gegründet worden war. Allerdings sind zu dem genauen Zeitpunkt auf Grund von fehlenden Dokumenten eine Aussagen mehr zu treffen.
Das Kloster wurde im Laufe der Zeit mehrmals von Bränden heimgesucht. So gab es 1369 einen schweren Brand, bei dem weite Teile der Klosteranlage und der Kirche vernichtet wurden. Nach
dem anschließenden Wiederaufbau, der sich über mehr als 20 Jahre hinzog lebten nur noch etwa
zwölf Konventsdamen im Kloster Gutenzell. Ihre Zahl sollte sich im Laufe der Jahrhunderte bis auf
eine Ausnahme auch nie gravierend erhöhen.
Der Konvent verfügte über umfangreiche Ländereien in der Umgebung. Diese Tatsache und die Erlangung der Reichsunmittelbarkeit im Jahre 1521 führten, nachdem das Kloster zu Beginn des Jahrhunderts zunächst zahlreiche Zerstörungen und Plünderungen über sich ergehen lassen musste, zu einer Blütezeit in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Besonders unter der Äbtissin Maria Segesser von Brunegg (1567-1610) wurden zahlreiche Gebäude, vor allem wirtschaftlicher Art, neu- und umgebaut. Neben Maßnahmen an Kirche und Konvent, wurden etwa ein Badhaus, eine Sägemühle und eine Ziegelhütte (1585) errichtet. Die Lage verschlechterte sich allerdings ab der Jahrhundertwende: Bereits 50 Jahre zuvor waren von der Römisch-Katholischen Kirche im Tridentiner Konzil (1545-1563) zahlreiche Reformen bezüglich der Kirche sowie der Struktur der Klöster und des monastischen Lebens beschlossen worden. Wichtige Punkte waren dabei die Einführung „regelmäßiger Visitationen, strenge Klausur, Verzicht auf Privateigentum und strickte Erhaltung der klösterlichen Disziplin“2. Die Schwestern im Kloster Gutenzell widersetzten sich allerdings lange Zeit standhaft der Einführung dieser Reformen, was dazu führte, dass sie 1624 jegliche Unterstützung, auch von päpstlicher Seite, verloren und ihr Widerstand gar als „rebellione contra ordinis nostri consuetudines“ gewertet wurde. Die Androhung der Exkommunikation schien dann allerdings eindringlich genug, so dass ein Jahr später die Frauen im Kloster Gutenzell ihren Widerstand aufgaben und sich zur Annahme der Reformen bereit erklärten, die dann in Zukunft eine erhebliche Einschränkung für das Leben innerhalb des Konvents darstellen sollten. Doch damit nicht genug, zusätzlich wurde das Kloster durch den 30jährigen Krieg bedroht,
während dem es große Verluste zu erleiden hatte. Die Schwestern mussten mehrmals vor feindlichen Truppen fliehen, zahlreiche Ländereien mussten verkauft werden und 1631 brannte ein
Großteil der Anlage nach einem Blitzeinschlag aus. Erst 1650 nach Ende des Krieges und dem Abzug der letzten Soldaten konnte mit dem Wiederaufbau der Klosteranlage begonnen werden. In der folgenden Zeit erholte sich der Konvent langsam wieder und strebte seiner letzten großen Blüte entgegen. Eine wichtige Errungenschaft in dieser Phase war die Erlangung der hohen Jurisdiktion, welche das Kloster 1681 erhielt. Vier Jahre später folgte dann auch die Hoheit über die Blutgerichtsbarkeit, die allerdings befristet war und 1717 wieder abgetreten werden musste
und erst 1768 wieder in Gutenzellsche Hände gelangte. Wie bereits erwähnt, bedeutete dieses Jahrhundert einen letzten großen Aufschwung für den kleinen Konvent. Indizien hierfür sind unter anderem der aufwändige Ausbau und die Neugestaltung der Klosterkirche in den Jahren zwischen 1755 und 1770 sowie die steigende Anzahl der Mitglieder. Waren es 1682 noch acht Chordamen und zehn Laienschwestern, so hatte sich die Zahl 100 Jahre später nahezu verdoppelt und der Konvent zählte 24 Chordamen und 13 Laienschwestern.
Nach der Säkularisation 1803 kam es zu einer raschen Zersetzung der Gemeinschaft in Gutenzell. Die bereits 1790 in Frankreich begonnene Auflösung der Klöster erreichte Anfang des 19. Jahrhunderts auch deutsche Gebiete. Bereits 1802 wurde das Gebiet des Klosters Gutenzell
den Ländereien zugeschlagen, die als Entschädigung für die in den napoleonischen Kriegen verloren gegangene linksrheinische Besitzungen zur Verfügung stehen mussten. Ein Jahr später fiel der Konvent mit sämtlichen Rechten und Besitzungen endgültig an den Grafen Joseph August zu Toerring-Jettenbuch, als Wiedergutmachung für dessen verlorene Ländereien. Dieser stimmte zwar zu, dass die noch verbliebenen Konventsdamen weiterhin im Kloster wohnen konnten, allerdings durften keine neuen Anwärterinnen aufgenommen werden. Als 1851 die letzte noch verbliebene Konventsdame gestorben war, standen die Gebäude leer und wurden keiner neuen Nutzung zugeteilt. Daraufhin wurde ein Großteil des Baus 1864 bis auf einen Teil des Ostflügels und der Kirche abgerissen.
Quelle: Maegraith, Janine Christina: Das Zisterzienserinnenkloster Gutenzell. Vom Reichskloster zur geduldeten Frauengemeinschaft, in: Oberschwaben-Geschichte und Kultur, 15, Epfendorf 2006
(1238)
- Sakralbauten
- Kloster, allgemein
(1369)
(1631)
(1750 - 1770)
Die Gewölbe im Mittelschiff gehen auf die letzte große Umbaumaßnahme im Spätbarock resp. Rokoko, auf die Pläne von Dominikus Zimmermann zurück; sie wurden ausgeführt vom Kirchenbaumeister Nikolaus Rüeff. Zeitgleich wurden die Pfeiler ummantelt und der Obergaden verändert. Das Stuckwerk stammt von Franz X. Feichtmayer, die Deckengemälde von Johann G. Dieffenbrunner. (a, s)

- Ausstattung
- Sakralbauten
- Klosterkirche
- Detail (Ausstattung)
- bemerkenswerte Fenster
- bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
- bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
(1802)
Beschreibung
- Klosteranlage
- allgemein
- Sakralbauten
- Frauenkloster
Zonierung: