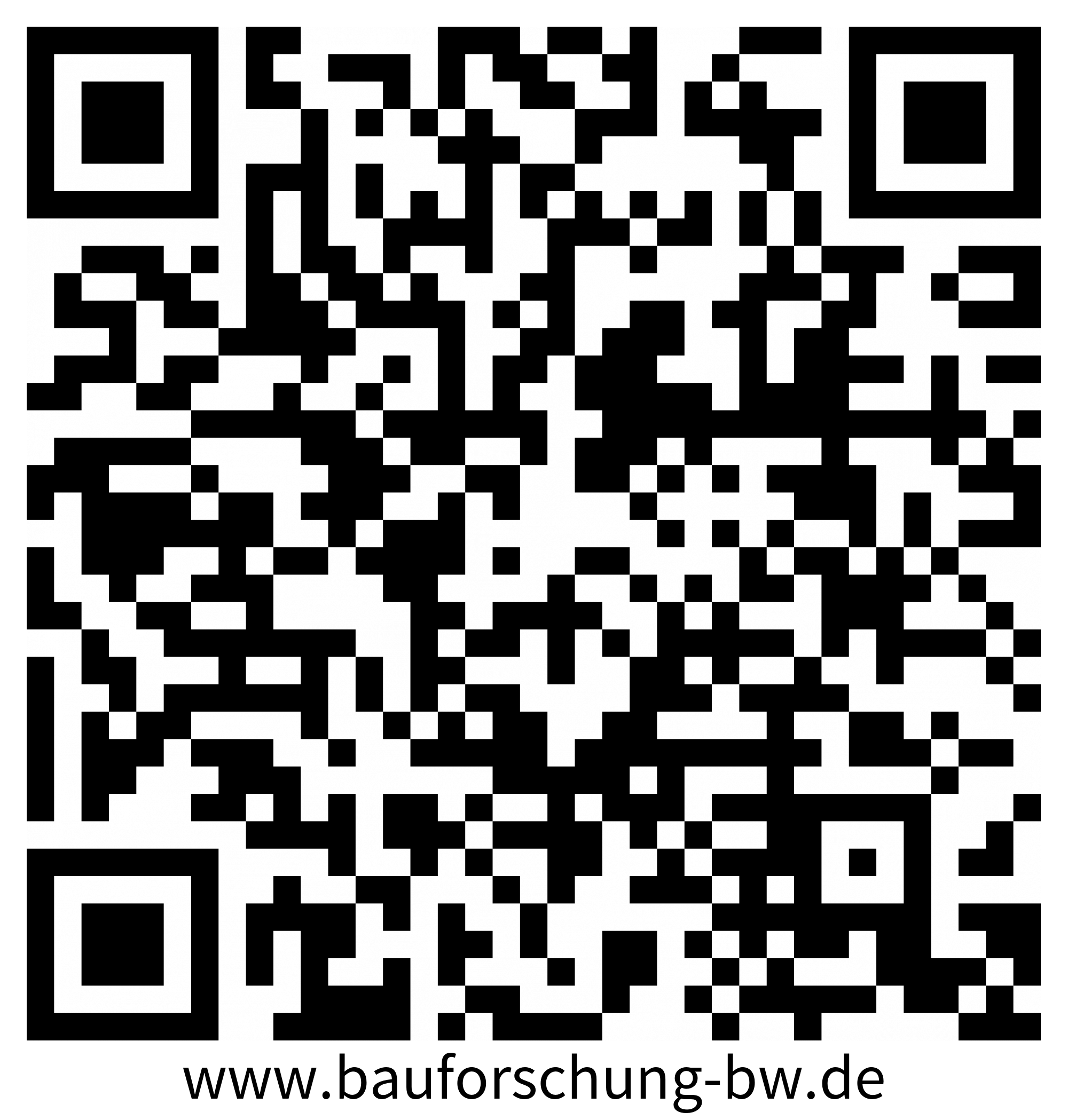Dachwerke der Klostergebäude
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Rathausplatz |
| Hausnummer: | 1 |
| Postleitzahl: | 79274 |
| Stadt-Teilort: | St. Märgen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8315094069 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
| Geo-Koordinaten: | 48,0062° nördliche Breite, 8,0924° östliche Länge |
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Bauphasen
Trotz der verheerenden Brandkatastrophe der Klosteranlage im Jahr 1907 haben sich auf dem größten Teil des Klostergebäudes noch die ursprünglichen Dachwerke aus der Bauzeit im 18. Jahrhundert erhalten, darunter eine bemerkenswerte Konstruktion über dem Kapitelsaal in der Mitte des Ostflügels.
Dendrochronologische Altersbestimmungen wurden keine vorgenommen.
Angaben zur Baugeschichte gehen alle auf Elisabeth Irtenkauf zurück und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
Anhand der einzelnen, in abgewandelter Konstruktionsweise errichteten Dachwerke kann die Baugeschichte des Klostergebäudes nachvollzogen werden. Fünf aufeinanderfolgende Einheiten von sehr unterschiedlicher Ausdehnung lassen sich unterscheiden. Sie wurden nacheinander aufgeschlagen, beginnend über dem Südflügel, fortgesetzt über dem Ostflügel und abschließend über dem Torbau im Nordflügel.
(1725)
An dieses früheste Dach wurde ein kurzer Dachwerksabschnitt in einer Länge von nur drei Querzonen angefügt. Die aus der Baugeschichte abzuleitende Datierung dieses Dachwerks fällt ebenfalls ins Jahr 1725*

- Dachgeschoss(e)
(1739)

- Dachgeschoss(e)
- Anbau
(1761)
Den letzten Abschnitt bildet das Dachwerk vom westlichen Teil des Nordflügels über der Tordurchfahrt, der unmittelbar an den Chor der ehemaligen Klosterkirche anschließt. Er ist ebenfalls 1761* aufgerichtet worden

- Dachgeschoss(e)
- Anbau
Zugeordnete Dokumentationen
- Baugeschichtliche Dokumentation Dachwerke der Klostergebäude
- Restauratorische Untersuchungen
Zonierung:
Konstruktionen
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
oberen Ende durch einen horizontalen Spannriegel verbunden, womit sie eine Art Bock bilden, der von kurzen Kopfstreben in den oberen stumpfen Winkeln versteift wird. Binderquerachsen dieser Form sind in größeren Abständen voneinander aufgestellt. Die Bereiche dazwischen werden als Querzonen bezeichnet. Von den Binderquerachsen werden zwei Stuhlpfetten getragen, die das Dach in seiner gesamten Länge durchlaufen und dabei die einzelnen Sparrendreiecke stützen. Innerhalb der Querzonen sind in den Feldern zwischen Stuhlständern und Stuhlpfetten unter der Dachfläche schräg verlaufend Hölzer angeordnet, die eine Aussteifung des Dachwerks in Längsrichtung bewirken.
Liegende Stühle wurden in leicht abgewandelten Konstruktionsvarianten und unterschiedlichen Detailformen ausgeführt – so auch hier im Dach der Klostergebäude. Die Stuhlpfetten haben einen rechteckigen, aufrechten oder einen polygonalen, dem Dachflächenwinkel angepassten Querschnitt. Die liegenden Stuhlständer sind direkt in die Dachbalken gezapft oder ebenfalls polygonal geformten Schwellen aufgesetzt. Davon abhängig waren Varianten bei der Anordnung der Längsaussteifung möglich. Auf zimmerungstechnische Einzelheiten wird im folgenden Text nur dann näher eingegangen, sofern sie Schlüsse auf die Baugeschichte erlauben. Für alle Dachwerke fand ausschließlich Nadelholz Verwendung.
Ältester Bestandteil der Dachkonstruktion ist der bescheidene Rest eines Dachwerks, das sich einst weiter nach Westen erstreckt hat. Geblieben ist davon lediglich eine einzige Binderquerachse, und diese nur zur Hälfte, die das Dachwerk nach Osten abgeschlossen hatte. Um sie herum wurde nachträglich eine Bruchsteinwand hochgemauert, vermutlich als nach Auflösung des Klosters die Gebäude besitzrechtlich geteilt worden sind. Dieses Mauerwerk hat bei der Brandkatastrophe 1907 das Feuer aufgehalten und nicht nur die darin eingemauerten Hölzer, sondern alle hier behandelten Dachwerke vor der Zerstörung bewahrt. Aus der Baugeschichte des Klosters lässt sich die Errichtung des Dachwerks im Jahr 1725 erschließen*.
An dieses früheste Dach wurde ein kurzer Dachwerksabschnitt in einer Länge von nur drei Querzonen angefügt. Er wurde direkt an das oben beschriebene Dachwerk angeschlossen und deshalb am westlichen Ende keine eigene Binderquerachse ausgebildet. Auf der Ostseite endet die Konstruktion mit einer offenen Binderquerachse, die keine Anzeichen für eine Fachwerkfüllung oder Verschalung, die als provisorischer Abschluss bis zum Weiterbau hätte dienen können, aufweist. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass hier ein gemauerter Giebel bestanden hat. Die aus der Baugeschichte abzuleitende Datierung dieses Dachwerks fällt ebenfalls ins Jahr 1725*.
Ein weiteres Dachwerk nimmt die verbleibende Länge des Südflügels ein und endet an einem massiven Steilgiebel aus Bruchsteinmauerwerk. Abgezimmert wurde es im Jahre 1739*. Im Unterschied zum vorangehenden Dachwerk sind die Stuhlpfetten mit polygonalem Querschnitt ausgebildet.
Der Ostflügel und die östliche Hälfte des Nordflügels besitzen zwar eigenständig konstruierte Dachwerke, die aber bis in Details genau dieselbe konstruktive Ausbildung zeigen und offensichtlich im Zusammenhang errichtet worden sind. Dies ist um 1761* geschehen. Im Unterscheid zu allen anderen Dachwerken ruhen hier die Stuhlständer auf Schwellen. Der Nordflügel schließt nach Osten mit einem gemauerten Steilgiebel ab und bildet das Pendant zum Südflügel, während das Dachwerk des Ostflügels gegen die durchlaufenden Sparrenlagen von Süd- und Nordflügel läuft und seine Stuhlpfetten den ihren aufliegen.
Der mittlere Abschnitt des Ostflügeldachs ist als Sonderkonstruktion ausgebildet, die zwischen gewöhnlichen liegenden Stuhlkonstruktionen sitzt. Der große Kapitelsaal im Obergeschoss tritt hier in einem Mittelrisalit nach Osten vor die Fassadenflucht und besitzt mehr Raumhöhe. Dies hat zur Folge, dass sein Deckengebälk um etwa einen Meter über dem übrigen Dachboden liegt und die Dachtraufe an der Ostseite höher reicht. Auch mit Hilfe der Dachform wird der Saal als bedeutendster Raum des Klosters architektonisch besonders hervorgehoben. Der Dachfirst liegt hier deutlich höher und nach Osten ist ein Mansarddach mit wechselndem Neigungswinkel als Vollwalm ausgebildet. Zum Innenhof hin besteht jedoch eine gemeinsame geschlossene Dachfläche über die ganze Länge des Ostflügels.
Im Querschnitt entstand eine unsymmetrische Dachform, deren konstruktive Ausbildung aber auch hier auf einem liegenden Stuhl beruht. Die hofseitigen, westlichen Stuhlständer mussten dafür deutlich verlängert ausgebildet werden, um das Kehlgebälk höher anordnen zu können. Talseitig nach Osten stehen jedoch nur kurze, steil gestellte Stuhlständer auf erhöhter Ebene, die das Mansarddach erzeugen. Der Größe des Daches wegen ist darüber ein zweites Dachgeschoss mit liegender Stuhlkonstruktion abgezimmert, welche im Detail etwas einfacher ausgebildet ist und auf Schwellen verzichtet.
Die eigenwillige Ausbildung dieser Dachkonstruktion führte in der Folgezeit in zweierlei Hinsicht zu Schadensbildern. Eine der Ursachen war die unsymmetrische Kombination besonders langer und besonders kurzer, steil gestellter liegender Stuhlständer. Hierbei wurde das statische Grundprinzip einer liegenden Stuhlkonstruktion missachtet, denn nur bei einem symmetrisch aufgebauten Stuhl heben sich die Schubkräfte, die durch die Schrägstellung der Ständer entstehen, gegenseitig auf. Hier jedoch konnte der kurze östliche Ständer dem sehr viel höheren Schub des westlichen nicht standhalten. Er wich aus, die Konstruktion verformte sich und hatte eine Einsenkung der westlichen Dachfläche zur Folge. Mehrere Stützmaßnahmen wurden im Laufe der Zeit dagegen ergriffen. Eine weitere Schwäche der Konstruktion lag in der großen Spannweite der Deckenbalken, die freitragend über die ganze Breite des Saals spannen mussten – während bei allen anderen Dächern die Spannweite durch eine Flurwand reduziert werden konnte – und sich durchgebogen haben. Sie sind im Lauf der Zeit mehrfach durch Überzüge und Abhängungen abgefangen worden. An den späteren
Nachbesserungen werden die Defizite dieser Konstruktionsweise deutlich. Gemessen am damals Möglichen hätte schon bei der Errichtung sowohl die asymmetrische Anordnung des liegenden Stuhls durch eine zusätzliche Querverstrebung, als auch die weite Spannweite des Deckengebälks durch eine Abhängung der Deckenbalken im Dachwerk bewältigt werden können.
Den letzten Abschnitt bildet das Dachwerk vom westlichen Teil des Nordflügels über der Tordurchfahrt, der unmittelbar an den Chor der ehemaligen Klosterkirche anschließt. Er ist ebenfalls 1761* aufgerichtet worden. Dieser Gebäudeteil ist gegenüber dem östlichen Teil des Nordflügels etwas schmaler bemessen, entspricht in seiner Breite aber der Chorschlusswand. Da eine geschlossene Dachfläche über den gesamten Nordflügel geschaffen wurde, besteht hier ein zusätzliches Zwischengeschoss. Die westliche Dachspitze ist angekohlt, was auf den Brand der Kirche um 1907 zurückgeht und seine Ursache in einer kleinen Öffnung zum Chorraum hin hatte (Auskunft von Herrn Klaus Hog).
Die Konstruktionsweise dieses Dachwerks unterscheidet sich von den bisher beschriebenen. Der Stuhl besteht aus jeweils zwei gegeneinander gelehnten Stuhlständern, die an der Spitze eine Firstpfette tragen. Die in Quer- und Längsrichtung aussteifenden Hölzer sind nicht, wie bei den übrigen Dachwerken, eingezapft, sondern sie sind angeblattet. Mit diesen Merkmalen geht dieses Dachwerk auf eine gänzlich andere Tradition zurück als die anderen hier beschriebenen, nämlich die des südlichen und mittleren Schwarzwaldes, wo über längere Zeit hinweg eine eigenständige Entwicklung des Holzbaus stattgefunden hat. Dieselbe Dachkonstruktion findet sich auf kleineren Gebäuden wie Speichern und Mühlen oder auf großen Hofgebäuden als zweites Dachgeschoss wieder.
Das Nebeneinander von lokalen, für den Schwarzwald typischen Bauweisen auf der einen und liegenden Stuhlkonstruktionen und Mansarddächern als zeitgenössischen Konstruktions- und Architekturformen auf der anderen Seite belegen, dass hier Zimmerleute von gänzlich unterschiedlicher Ausbildung und Herkunft tätig waren.