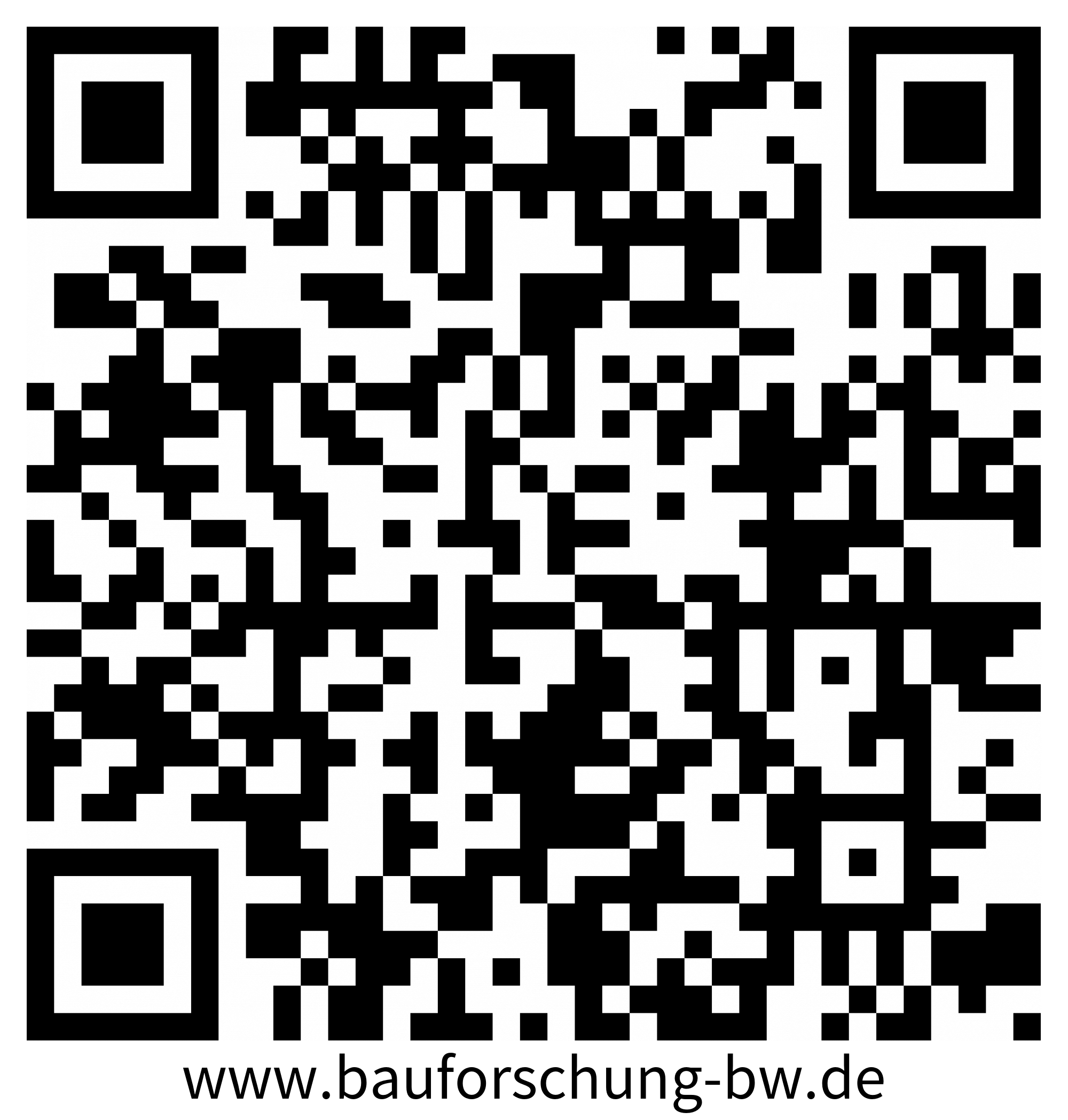Wohn- und Ökonomiegebäude
ID:
117358059510
/
Datum:
01.08.2012
Datenbestand: Bauforschung
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Metzinger Straße |
| Hausnummer: | 36 |
| Postleitzahl: | 72581 |
| Stadt-Teilort: | Dettingen an der Erms |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Reutlingen (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8415014002 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Durch Ihre Cookie-Auswahl haben Sie die Kartenansicht deaktiviert, die eigentlich hier angezeigt werden würde. Wenn Sie die Kartenansicht nutzen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen unter Impressum & Datenschutzerklärung an.
Eindachhaus (72581 Dettingen a. d. Erms, Lange Gasse 2)
Zwiefalter Hof, Lange Gasse 22 (72581 Dettingen)
Zwiefalter Hof, Lange Gasse 22 (72581 Dettingen)
Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:
Das Wohn- und Ökonomiegebäude Metzinger Straße 36 in Dettingen an der Erms wurde um 1684 als zweigeschossiger Fachwerkbau über einem wohl älteren Gewölbekeller errichtet. Bis heute haben sich große Teile der Primärkonstruktion des Fachwerkbaus erhalten. Im 18./19. Jahrhundert erfolgten bauliche Veränderungen an den Fachwerkfassaden. Größere Umbaumaßnahmen erfolgten erst im 20. Jahrhundert mit der Verlängerung des Ökonomieteils nach Norden und dem Ausbau des alten Scheunenbereiches zu Wohnzwecken.
1. Bauphase:
(1500 - 1599)
(1500 - 1599)
Der große, unter dem ältesten Gebäudeteil befindliche Gewölbekeller weicht mit seinen Außenwandfluchten von den Fluchten des heutigen Gebäudes ab. Zudem spricht die Versetztechnik der hammerrecht bearbeiteten Sandsteine für eine Datierung des Kellers ins 16. Jahrhundert. Somit kann davon ausgegangen werden, dass der Keller einem Vorgängergebäude angehörte. Möglicherweise wurde dieses in Folge des Dreißigjährigen Krieges zerstört. So ist belegt, dass von ehemals 296 Häusern nach Kriegsende 1648 nur noch 108 standen.
Betroffene Gebäudeteile:

- Untergeschoss(e)
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
Konstruktionsdetail:
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
2. Bauphase:
(1684)
(1684)
Wie die nun durchgeführte dendrochronologische Altersbestimmung belegt wurde das Gebäude um das Jahr 1684 erbaut. Aus dieser Zeit stammen noch große Teile der Primärkonstruktion des Gebäudes. An Ausstattungselementen scheint sich jedoch augenscheinlich nichts erhalten zu haben.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
3. Bauphase:
(1700 - 1899)
(1700 - 1899)
Im Laufe des 18. oder 19. Jahrhunderts wurden diverse Veränderungen an den Fachwerkfassaden der beiden Vollgeschosse durchgeführt. Die Fenstergliederungen wurden (besonders im Erdgeschoss) symmetrisch angelegt.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
4. Bauphase:
(1905)
(1905)
Laut eines Baugesuchs vom April 1905 wurde der Ökonomieteil in dieser Zeit nach Norden verlängert. Dabei wurde im 1. Dachgeschoss eine liegende Bundachse von 1684 um ein Gespärre nach Norden versetzt.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
5. Bauphase:
(1959 - 1980)
(1959 - 1980)
Wie Baugesuchsunterlagen von 1959 und 1979 belegen, wurden in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts diverse bauliche Veränderungen am Gebäude durchgeführt. So wurde der ehemalige Ökonomieteil von 1684 im Erdgeschoss zu Wohnzwecken umgenutzt und entsprechend ausgebaut. Des weiteren stammen heute nahezu alle Türen und Fenster des Gebäudes aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Kurzuntersuchung
Beschreibung
Umgebung, Lage:
Das Gebäude Metzinger Straße 36 befindet sich am westlichen Rand des historischen Ortskerns an einer ehemals wichtigen Verbindungsstraße zwischen Metzingen und Bad Urach.
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Bei dem Anwesen handelt es sich um ein Streckgehöft mit südlich gelegenem Wohnhaus und nördlich anschließendem Ökonomieteil. Bei dem giebelständigen Gebäude handelt es sich um ein
zweigeschossiges, teils verputztes, teils fachwerksichtiges Wohnhaus. Nach oben schließt das Wohngebäude mit zwei Dachgeschossebenen und einem Spitzboden unter einem Satteldach ab.
Die einzelnen Geschosse stoßen an der südlichen Giebelseite und an der östlichen Traufseite jeweils leicht vor. Bemerkenswert sind die Zierelemente am Fachwerk: kielbogig gefaste Schwellen, geschnitzte Kopfwinkelhölzer, geschnitzte Knaggen, Rauten, geschweifte
Andreaskreuze und eine Rosette in der Giebelspitze.
zweigeschossiges, teils verputztes, teils fachwerksichtiges Wohnhaus. Nach oben schließt das Wohngebäude mit zwei Dachgeschossebenen und einem Spitzboden unter einem Satteldach ab.
Die einzelnen Geschosse stoßen an der südlichen Giebelseite und an der östlichen Traufseite jeweils leicht vor. Bemerkenswert sind die Zierelemente am Fachwerk: kielbogig gefaste Schwellen, geschnitzte Kopfwinkelhölzer, geschnitzte Knaggen, Rauten, geschweifte
Andreaskreuze und eine Rosette in der Giebelspitze.
Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:
Zonierung:
Das Anwesen besteht im wesentlichen aus zwei Bauphasen. Im Süden steht der Wohnteil mit ehemaligem Scheunenteil (um 1684) und im Norden wurde 1905 der Ökonomieteil verlängert. Der
ältere, südliche Gebäudeteil ist mit einem großen Gewölbekeller unterkellert. Dieser könnte aufgrund der Abweichung der Außenwandfluchten und der nachträglichen Erweiterung nach Süden noch einem älteren Vorgängergebäude angehören.
Die Grundrissgliederung des Wohnhauses lässt sich noch am besten im 1. Dachgeschoss ablesen. Der Wohnteil besitzt zwei Längszonen und zwei Querzonen. Der Scheunenteil besaß
ursprünglich wohl zwei weitere Querzonen. Das Erdgeschoss nimmt heute zwei Wohneinheiten auf, wobei die nördliche Wohnung teilweise in die ehemalige Scheune (Tenne) eingebaut wurde. Im Obergeschoss befindet sich eine Wohnung im ursprünglichen Wohnteil. Der nördliche Scheunenteil ist weitestgehend unausgebaut. Das 1. und 2. Dachgeschoss ist - abgesehen von zwei Dachkammern bis heute unausgebaut und dient zu Lagerzwecken.
ältere, südliche Gebäudeteil ist mit einem großen Gewölbekeller unterkellert. Dieser könnte aufgrund der Abweichung der Außenwandfluchten und der nachträglichen Erweiterung nach Süden noch einem älteren Vorgängergebäude angehören.
Die Grundrissgliederung des Wohnhauses lässt sich noch am besten im 1. Dachgeschoss ablesen. Der Wohnteil besitzt zwei Längszonen und zwei Querzonen. Der Scheunenteil besaß
ursprünglich wohl zwei weitere Querzonen. Das Erdgeschoss nimmt heute zwei Wohneinheiten auf, wobei die nördliche Wohnung teilweise in die ehemalige Scheune (Tenne) eingebaut wurde. Im Obergeschoss befindet sich eine Wohnung im ursprünglichen Wohnteil. Der nördliche Scheunenteil ist weitestgehend unausgebaut. Das 1. und 2. Dachgeschoss ist - abgesehen von zwei Dachkammern bis heute unausgebaut und dient zu Lagerzwecken.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben
Bestand/Ausstattung:
keine Angaben
Konstruktionen
Konstruktionsdetail:
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
- Flechtwerk
- Decken
- Balkendecke
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
- Verwendete Materialien
- Holz
- Stein
- Dachform
- Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Holzgerüstbau
- Unterbaugerüst, mehrstöckig
Konstruktion/Material:
Über dem massiv aus hammerrecht bearbeiteten Sandsteinen erbauten Gewölbekeller erhebt sich ein stockwerksweise abgezimmerter Fachwerkbau mit durchgängig vorhandenen, verzapften
Holzverbindungen. Bemerkenswert ist hierbei jedoch, dass die Kehlbalken im 2. Dachgeschoss an die Sparren angeblattet wurden, was für das ausgehende 17. Jahrhundert eher ungewöhnlich ist.
Die historischen Fachwerkwände wurden weitestgehend mit Lehmflechtwerk ausgefacht. Das rußgeschwärzte Dachtragwerk des Gebäudes wurde im 1. Dachgeschoss als stehende Stuhlkonstruktion mit Mittellängsunterzug errichtet. Im 2. Dachgeschoss befinden sich lediglich die
durchgehenden Sparrenpaare und Kehlbalken. Abbundzeichen in Form von römischen Ziffern konnten an den Querbundachsen und den Kehlbalken nachgewiesen werden. Diese laufen in logischer Zählung durch, so dass von einer einheitlichen, zeitgleichen Errichtung des Dachtragwerks ausgegangen werden kann. Die Hölzer der Primärkonstruktion des ältesten, südlichen Gebäudeteils
konnten nun dendrochronologisch auf Fällungen zwischen Winter 1681/82 bis Sommer 1684 datiert werden, so dass von einer Erbauung des Wohnhauses im Jahr 1684 ausgegangen werden kann.
Holzverbindungen. Bemerkenswert ist hierbei jedoch, dass die Kehlbalken im 2. Dachgeschoss an die Sparren angeblattet wurden, was für das ausgehende 17. Jahrhundert eher ungewöhnlich ist.
Die historischen Fachwerkwände wurden weitestgehend mit Lehmflechtwerk ausgefacht. Das rußgeschwärzte Dachtragwerk des Gebäudes wurde im 1. Dachgeschoss als stehende Stuhlkonstruktion mit Mittellängsunterzug errichtet. Im 2. Dachgeschoss befinden sich lediglich die
durchgehenden Sparrenpaare und Kehlbalken. Abbundzeichen in Form von römischen Ziffern konnten an den Querbundachsen und den Kehlbalken nachgewiesen werden. Diese laufen in logischer Zählung durch, so dass von einer einheitlichen, zeitgleichen Errichtung des Dachtragwerks ausgegangen werden kann. Die Hölzer der Primärkonstruktion des ältesten, südlichen Gebäudeteils
konnten nun dendrochronologisch auf Fällungen zwischen Winter 1681/82 bis Sommer 1684 datiert werden, so dass von einer Erbauung des Wohnhauses im Jahr 1684 ausgegangen werden kann.